
Folgen destruktiver Führung
Empathie im Job steigert Leistung und Motivation
Karriere? Lieber nicht - Bürokratie und fehlender Gestaltungsraum schrecken viele ab. Fachleute warnen, dass schlechte Führung krank macht. Sie sehen aber auch ein politisches Problem.
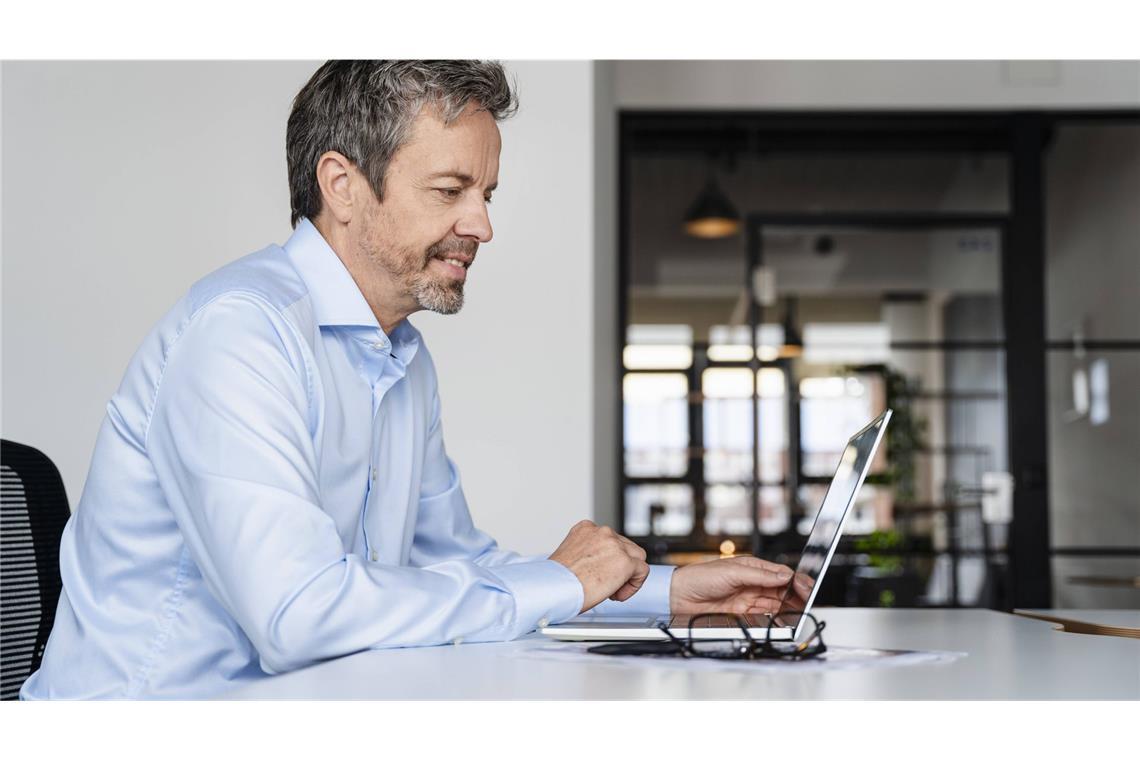
Fachleute warnen, dass destruktive Führung krank macht. (Symbolbild)
Von red/kna
Viel zu tun zu haben erhöht allein nicht das Risiko für einen Burnout. Wer etwas erreiche, habe auch bei viel Arbeit ein geringeres Risiko für diese Erkrankung als jemand, dessen Bemühungen verpufften, sagte der Psychologe Ortwin Meiss am Mittwochabend bei einer Veranstaltung der Friedrich-Naumann-Stiftung für Freiheit. Allerdings würden Selbstwirksamkeit und Wertschätzung durch Vorgesetzte oft vermisst.
Es kränke Menschen im wahrsten Sinne des Wortes, wenn sie nicht beachtet oder herabgewürdigt werden, warnte Meiss. Studien zeigten, dass das Immunsystem etwa auf öffentliche Kritik geschwächt reagiere. Führungspersonal müsse daher nicht nur fachlich geeignet sein, sondern auch Empathie zeigen und darauf eingehen, was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bräuchten.
Influencer wecken falsche Hoffnungen
Der Psychotherapeut hat Olympia-Sportlerinnen und Fußballer etwa vom FC Sankt Pauli mental gecoacht. Entscheidend sei, wie jemand mit Misserfolg umgehe: „Influencer gaukeln jungen Menschen heute vor, dass man alles schnell und einfach hinbekommt, wenn man eine Idee kurz mal promotet. Bei den meisten Leuten, die erfolgreich sind, steckt jedoch Hartnäckigkeit dahinter.“
Die Wirtschaftspsychologin Anita Rick-Blunck appellierte an Führungskräfte, mit gutem Beispiel voranzugehen, Leistung zu würdigen, aber auch mit Fehlern offen umzugehen. Wenn ein Team gemeinsam lerne, könne dies zu einem Motivationsschub führen. In Umfragen gäben indes immer weniger Menschen an, dass sie ihrer Arbeit hochmotiviert nachgingen.
Gesellschaft als „Ponyhof“?
Einerseits gebe es einen gewissen „Trend in Richtung Ponyhof“ in der Gesellschaft, erklärte Rink-Blunck. Andererseits steige die Arbeitsleistung nachweislich um bis zu 20 Prozent, wenn Mitarbeitende zufrieden seien - und dafür sei das Emotionale ein wichtiger Faktor. „Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist viel entscheidender als früher, als es knallhart um Output ging.“
Dass sich immer weniger Menschen vorstellen könnten, beruflich aufzusteigen, hänge auch mit Bürokratie zusammen, kritisierte die Expertin. „Diejenigen an der Spitze sind mit Rechtfertigungs- und Dokumentierungszwang konfrontiert - das möchten viele nicht“, denen ihr „ureigener Arbeitsinhalt“ am Herzen liege. Die Politik sei daher gefragt, Freiräume zu schaffen und Menschen in Verantwortung nicht durch immer mehr Regularien einzuengen.