
Klimawandel im Prozess
So zutreffend waren die Klima-Prognosen der 1990er
Schon vor 30 Jahren waren die Prognosen für den klimabedingten Meeresspiegelanstieg erstaunlich treffsicher, obwohl es noch keine Satellitendaten gab. Ein Rückblick.
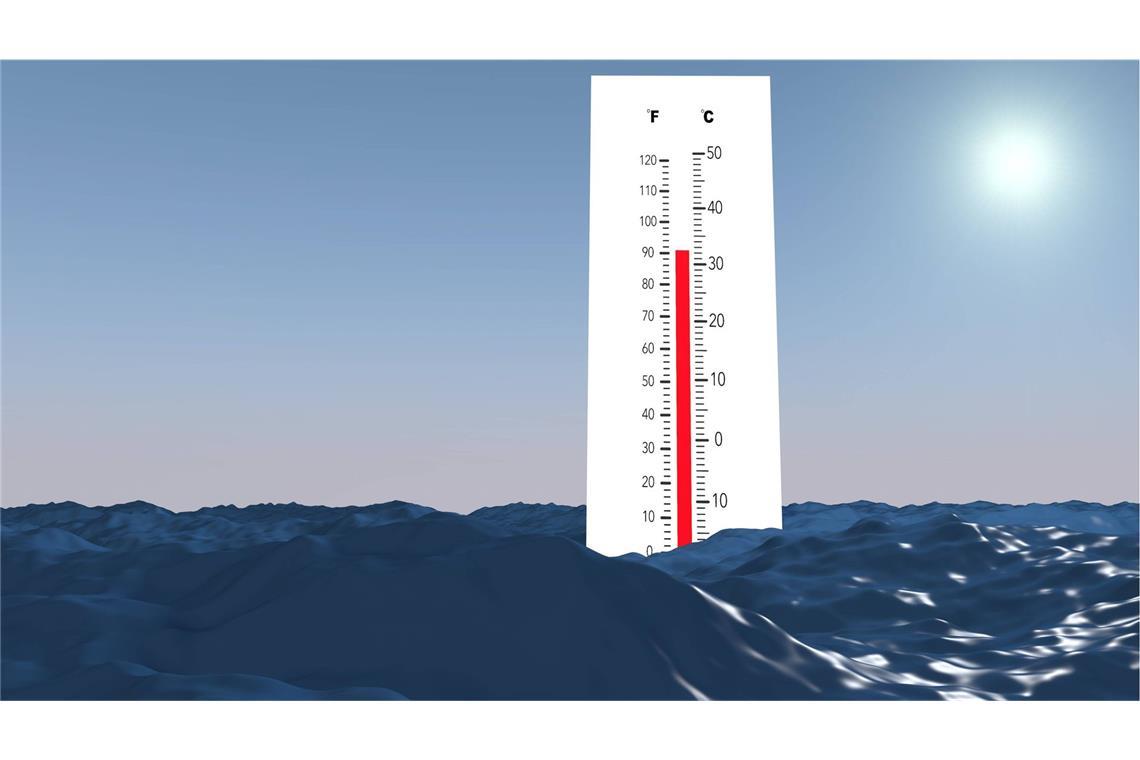
Die Weltmeere haben Fieber: Forscher haben sich den IPCC-Weltklimabericht von 1996 vorgenommen und die darin enthaltenen Meeresspiegel-Prognosen einem Realitäts-Check unterzogen.
Von Markus Brauer
Zvilisationskritiker sehen das Ende der Menschheit nicht erst jetzt heraufziehen. Schon im Jahr 1972 Jahren sorgte der „Club of Rome“ mit seiner apokalyptischen Zukunftsvision „Die Grenzen des Wachstums“ („The Limits to Growth“) für Furore.
Im Jahr 1977 gab der damalige US-Präsident Jimmy Carter „Global 2000. The Report to the President“ in Auftrag. Die fast 1200 Seiten dicke Umweltstudie befasste sich mit den grundlegenden Entwicklungen der Umweltbedingungen und ihre Auswirkungen auf die Zukunft der Menschheit bis zum Jahr 2000.
Unbegrenztes Wachstum, begrenzte Ressourcen
Allen Unkenrufen zum Trotz hat der moderne Mensch mit Hilfe seiner Rationalität und seines Erfindungsreichtums sowie des technischen Fortschritts noch immer eine Lösung gefunden:
Klimawandel: Immer realer und bedrohlicher
Doch wie lange wird das noch gut gehen? Dass angesichts der begrenzten Ressourcen ein globales Umdenken und Umsteuern stattfinden muss, ist unbestritten. Die Frage ist, wo der Hebel zu einem ökologisch nachhaltigen Weltwirtschaftssystem ansetzen soll. 8,2 Milliarden Menschen – bis 2050 könnten es mehr als zehn Milliarden sein – mit den elementaren Dingen des Lebens zu versorgen.
Das ist eine gewaltige Herausforderung, die nur durch mehr Wachstum zu leisten ist – anders als bisher allerdings mit weniger Naturverbrauch und Raubbau.
„Unser System frisst sich selbst auf“
Der Wandel in Richtung mehr Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit muss gelingen. Sollte er scheitern, werden sich die globalen Krisensymptome weiter verschärfen. Dann könnte die Warnung des australischen Umweltaktivisten und früheren Chefs von Greenpeace International, Paul Gilding, Wirklichkeit werden: „Mit dem Zwang zu immer mehr Wachstum und einer Überforderung des Planeten frisst sich unser System selbst auf.“
Der Klimawandel ist heute längst Realität. Er manifestiert sich in Hitzewellen und Temperaturrekorden, in Wetterextremen, einer sich beschleunigenden Eisschmelze und auch in immer schneller steigenden Meeresspiegeln. Attributionsstudien belegen immer häufiger, dass Extremereignisse und Klimakapriolen keine rein natürlichen Phänomene mehr sind, sondern auf unseren menschlichen Klimaeinfluss zurückgehen. Wir erleben heute genau das, wovor Klimaforscher schon vor Jahrzehnten gewarnt haben.
Wie treffsicher war der IPCC-Bericht von 1996?
Aber wie treffsicher waren diese frühen Klimaprognosen? Mit dieser Frage haben sich Torbjörn Törnqvist von der Tulane University in New Orleans und seine Kollegen nun untersucht. „Der ultimative Test für Klimavorhersagen ist es, sie im Nachhinein mit den tatsächlich eingetretenen Veränderungen zu vergleichen“, sagt Törnqvist.
Deshalb haben die Forscher sich den IPCC-Weltklimabericht von 1996 vorgenommen und die darin enthaltenen Meeresspiegel-Prognosen einem Realitäts-Check unterzogen.
„Vorhersagen des Meeresspiegels sind eine besondere Herausforderung, weil er durch sehr unterschiedliche Elemente des Klimasystems angetrieben wird, darunter die Ausdehnung des Meerwassers und den Eisverlust an Land“, erklären sie. Erschwerend kam hinzu: 1996 konnte der IPCC-Bericht noch keine Satellitendaten für seine Modelle und Prognosen nutzen, denn die satellitengestützte Überwachung von Klima und Ozeanen hatte damals gerade erst begonnen.
Der IPCC-Bericht von 1996 sagte für ein mittleres Klimawandelszenario einen Anstieg von acht Zentimetern in den nächsten 30 Jahren voraus. Hat sich dies bestätigt?
Um nur um einen Zentimeter verschätzt
Die vor 30 Jahren gemachte Prognose war schon erstaunlich treffsicher. Tatsächlich sind die Meeresspiegel seit 1996 um rund neun Zentimeter angestiegen. Der damalige Klimabericht lag damit einen Zentimeter zu niedrig. „Wir sind wirklich erstaunt, wie gut diese frühen Prognosen damit waren, vor allem, wenn man bedenkt, wie grob die Modelle damals noch waren“, erklärt Törnqvist.
Deutlich zeigt sich dieses noch unvollständige Wissen darin, wie die Klimaforscher damals die Eisschmelze unterschätzten. Vor 30 Jahren war beispielsweise noch nicht bekannt, wie stark veränderte Meeressströmungen und in die Schelfeisgebiete eindringendes Warmwasser die Gletscher und Schelfeise von unten her destabilisieren können. Auch wie sehr sich der Meeresspiegelanstieg dadurch beschleunigt hat, wurde erst vor wenigen Jahren entdeckt.
Klimaforschung sieht sich durch Entwicklung bestätigt
Insgesamt aber bestätigen die Ergebnisse, dass die Klimaforschung schon vor Jahrzehnten ziemlich gut voraussah, wie unser Klima heute aussehen wird. Die grundlegenden Prozesse – und auch die Rolle unserer Treibhausgas-Emissionen dafür – waren schon vor mehr als 30 Jahren wohlbekannt.
„Dies ist einer der besten Beweise dafür, dass wir schon vor Jahrzehnten verstanden haben, was da passiert“, konstatiert Törnqvist. „Es zeigt, dass die Klimaforschung glaubhafte Prognosen erstellt. Damals und heute.“
Gleichzeitig unterstreichen die Ergebnisse aber auch, wie wichtig es ist, den Zustand der Meere und Eismassen weiter genau zu überwachen und zu erforschen. „Diese Anstrengungen fortzusetzen ist wichtiger denn je und essenziell für informierte Entscheidungen“, betont Törnqvist.
Dieser Appell ist in den USA besonders nötig, denn US-Präsident Donald Trump und seine Regierung haben bereits massiv Gelder für die Klimaforschung gestrichen, Websites staatlicher Behörden zum Klimawandel vom Netz genommen und auch mehrere Satellitenmissionen zur Klimaüberwachung sollen vorzeitig beendet werden.
Kaskade von Kipppelementen
Schon ein geringer Anstieg der Treibhausgase durch die globale Erwärmung kann eine Kaskade von Kippelementen im Klimasystem der Erde auslösen, die weitere Erwärmungsprozesse nach sich ziehen. Dies könnte zu einem Warmzeitalter führen, das die Erde buchstäblich in ein Treibhaus verwandelt.
Doch bereits die klimatische Entwicklung zuvor wäre für Menschen und viele andere Lebewesen und Pflanzen brandgefährlich. Steigt nämlich die globale Temperatur schon um drei Grad an, könnte bis zu einem Drittel der Erde für die Menschheit nicht mehr oder nur noch unter enormem technischen Aufwand bewohnbar bleiben. Auch bestimmte Kipppunkte wären dann viel schneller erreicht.
„Es gibt eine kritische Schwelle für diese Menge an Wasserdampf, jenseits derer der Planet nicht mehr abkühlen kann. Von dort aus läuft alles aus dem Ruder, bis die Ozeane vollständig verdampfen und die Temperatur mehrere Hundert Grad erreicht“, unterstreicht der französische Klimaforscher Guillaume Chaverot.
Erderwärmung kommt schneller
In vielen Regionen der Erde könnte die Erwärmung schon Mitte dieses Jahrhunderts die Drei-Grad-Schwelle erreichen. Weit schneller als bislang vorhergesagt. Auch Mitteleuropa, das Mittelmeer, Südasien und Teile Afrikas gehören zu diesen Gebieten, wie KI-gestützte Klimaprognosen nahelegen. Demnach überschreiten 31 von 34 untersuchten Regionen schon 2040 die Zwei-Grad-Schwelle und 26 von 34 Regionen erreichen bis 2060 die Drei-Grad-Marke. Die Folgen dürften gravierend sein.
Starke Erwärmung in Europa
Bei weiter steigendem Treibhausgas-Ausstoß könnten die Temperaturen in Europa bereits bis 2060 um mindestens drei Grad verglichen mit den vorindustriellen Werten steigen. Das schließt ein Forscherteam aus einer KI-gestützten Analyse.
Europa erwärmt sich schneller als der globale Durchschnitt: 2023 war es bereits 2,3 Grad wärmer. Global waren es nach Daten des Klimadienstes Copernicus rund 1,48 Grad. Auch in den meisten anderen Regionen der Erde wird die Erderwärmung der neuen Auswertung zufolge wahrscheinlich schneller voranschreiten als vielen bisherigen Simulationen zufolge.
KI – ein leistungsfähiges Instrument
Die für die Analyse genutzte KI lernt anhand zehn globaler Klimamodelle, außerdem verfeinern Messdaten der vergangenen Jahre die Vorhersagen, wie das Team um Elizabeth Barnes von der Colorado State University in Fort Collins im Fachjournal „Environmental Research Letters“ berichtet.
SSP-Szenarien des Weltklimarates
Als Grundlage wurde der sozioökonomische Pfad SSP3-7.0 aus dem Sechsten Sachstandsbericht des Weltklimarates (IPCC) genommen. Dieses Szenario geht davon aus, dass der Treibhausgas-Ausstoß in einer von Konflikten und Nationalismus geprägten Welt weiter deutlich ansteigen wird. Zur Definition des aktuellen Klimazustands wurden die beobachteten Temperaturanomalien von 2023 herangezogen.
Schnellerer Anstieg als zumeist angenommen?
Demnach könnte schon 2040 oder früher für alle berücksichtigten 34 Regionen die 1,5-Grad-Schwelle erreicht sein, in 31 Regionen sogar schon zwei Grad.
Bei der Auswertung für das Erreichen von drei Grad über dem vorindustriellen Mittel überschritten 26 von 34 Regionen im Jahr 2060 die Grenze, darunter die vier Regionen in Europa.
Bislang lagen Prognosen zu einer globalen Durchschnittstemperatur bei diesem Szenario und zu diesem Zeitpunkt unter drei Grad.
Auch eine zweite Studie unter KI-Einsatz hat ergeben, dass die Erderwärmung wahrscheinlich schneller voranschreiten wird als in vielen bisherigen Simulationen berechnet. Temperaturen von zwei oder drei Grad über dem Durchschnitt des Zeitraums 1850 bis 1899 werden wahrscheinlich deutlich früher erreicht, als verbreitet angenommen.
Begrenzung auf 1,5 Grad unerreichbar
Das globale Ziel, die Erwärmung möglichst auf 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, ist der Auswertung zufolge inzwischen praktisch sicher unerreichbar. Zudem bestehe ein hohes Risiko, dass die globale Erwärmung die Zwei-Grad-Marke überschreitet, selbst wenn die Menschheit eine rasche Verringerung der Treibhausgas-Emissionen auf Null bis zu den 2050er-Jahren erreicht. Was das optimistischste Szenario darstellt, das in der Klimamodellierung weithin verwendet wird.
Frühere Studien waren zu dem Schluss gekommen, dass die Erderwärmung in diesem Fall wahrscheinlich unter zwei Grad gehalten werden könnte.
Gemeinsam mit Noah Diffenbaugh von der Stanford University hatte Barnes für die in den „Geophysical Research Letters“ vorgestellte Studie KI-gestützt untersucht, wie sich verschiedene Wege zu Netto-Null-Emissionen auf den Temperaturanstieg auswirken.
Höchstwahrscheinlich drei Grad wärmer
Wenn die Welt bis 2050 Netto-Null-Emissionen erreicht, wird das wärmste Einzeljahr dieses Jahrhunderts demnach höchstwahrscheinlich mindestens ein halbes Grad heißer sein als 2023, das bisher wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen.
Für ein Szenario, in dem die Emissionen zu langsam zurückgehen, um bis 2100 eine Netto-Null-Emission zu erreichen, ermittelten Diffenbaugh und Barnes, dass das wärmste Jahr weltweit höchstwahrscheinlich drei Grad wärmer sein wird als das vorindustrielle Basisszenario.
Dringend mehr Anpassung nötig
Die Forscher betonen, dass der Klimawandel in den kommenden Jahrzehnten große Auswirkungen haben wird, selbst wenn alle Anstrengungen und Investitionen in eine Reduzierung des Treibhausgas-Ausstoßes so erfolgreich wie nur möglich verlaufen.
„Es besteht ein reales Risiko, dass Menschen und Ökosysteme ohne entsprechende Investitionen in die Anpassung Klimabedingungen ausgesetzt werden, die viel extremer sind als das, worauf sie derzeit vorbereitet sind“, erklärt Diffenbaugh.
„Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Erwärmung in vielen Regionen schon in den nächsten zwei bis drei Jahrzehnten erreicht werden, bringt große Risiken mit sich“, wrnt Barnes. So drohen schwerwiegende Folgen für Wasserressourcen, Nahrungssicherheit, Ökosysteme, die menschliche Gesundheit und Wetterextreme.
Selbstverstärkender Effekt?
Experten sehen es als praktisch sicher an, dass dieses Jahr das vergangene als das wärmste Jahr ablösen wird. Die globalen Durchschnittstemperaturen werden voraussichtlich um mehr als 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau liegen, also bevor die Menschen begannen, fossile Brennstoffe in großem Umfang zu verbrennen. Das Pariser 1,5-Grad-Ziel zur Eindämmung der Klimakrise gilt damit aber noch nicht als verfehlt, da dafür auf längerfristige Durchschnittswerte geschaut wird.
Auf der Weltklimakonferenz 2015 in Paris hatten die Staaten weltweit vereinbart, die Erderwärmung auf unter zwei Grad zu begrenzen, möglichst aber auf 1,5 Grad. Die Werte haben hohen symbolischen Wert, eine klare Definition für die politisch festgelegten Schwellen gibt es Experten zufolge allerdings bisher nicht.
Info: SSPs-Szenarien der IPCC
SSPs Für Simulationen der zukünftigen Klimaentwicklung vergleicht der IPCC in seinem Sechsten Sachstandsbericht fünf unterschiedlichen Szenarien, die auf Englisch Shared Socioeconomic Pathways (SSPs) heißen (auf Deutsch: Gemeinsam genutzte sozioökonomische Pfade). Sie sind eine Weiterentwicklung der Zukunftsszenarien aus dem Fünften Sachstandsbericht des IPCC. Die SSPs unterscheiden sich voneinander unter anderem darin, wie viele Treibhausgasemissionen die Menschheit in Zukunft noch ausstößt, ab wann Klimaschutz betrieben wird und berechnen dann, wann – und ob – Netto-Null-Emissionen erreicht werden können.
Netto-Null Netto-Null heißt: Man geht nicht davon aus, dass tatsächlich der Ausstoß aller Treibhausgase auf Null gesenkt werden kann, etwa in der Landwirtschaft. Ein Rest an Emissionen müsste ausgeglichen werden durch sogenannte negative Emissionen, beispielsweise durch Wiederaufforstung oder die Speicherung von CO2 im Untergrund.
Klimaszenarien Die SSP-Szenarien werden in Klimamodelle eingegeben, und im Bericht wird ausgewertet, was in Zukunft innerhalb dieser Szenarien zu erwarten wäre. Die Spannweite der verschiedenen Szenarien ist im aktuellen Bericht noch etwas größer als zuvor. Es gibt zwei Szenarien mit niedrigen Treibhausgasemissionen (SSP1-1.9 und SSP1-2.6), die annehmen, dass die Emissionen bis ungefähr 2050 (SSP1-1.9) beziehungsweise 2070 (SSP1-2.6) Netto-Null erreichen.