
Künstliche Intelligenz
Wer besitzt die Dampfmaschine der Zukunft?
US-Firmen setzen Maßstäbe in Sachen KI. Vielleicht werden sie bald überholt von den Chinesen, die etwas haben, was genauso wichtig ist wie Chips, kommentiert Rainer Pörtner.
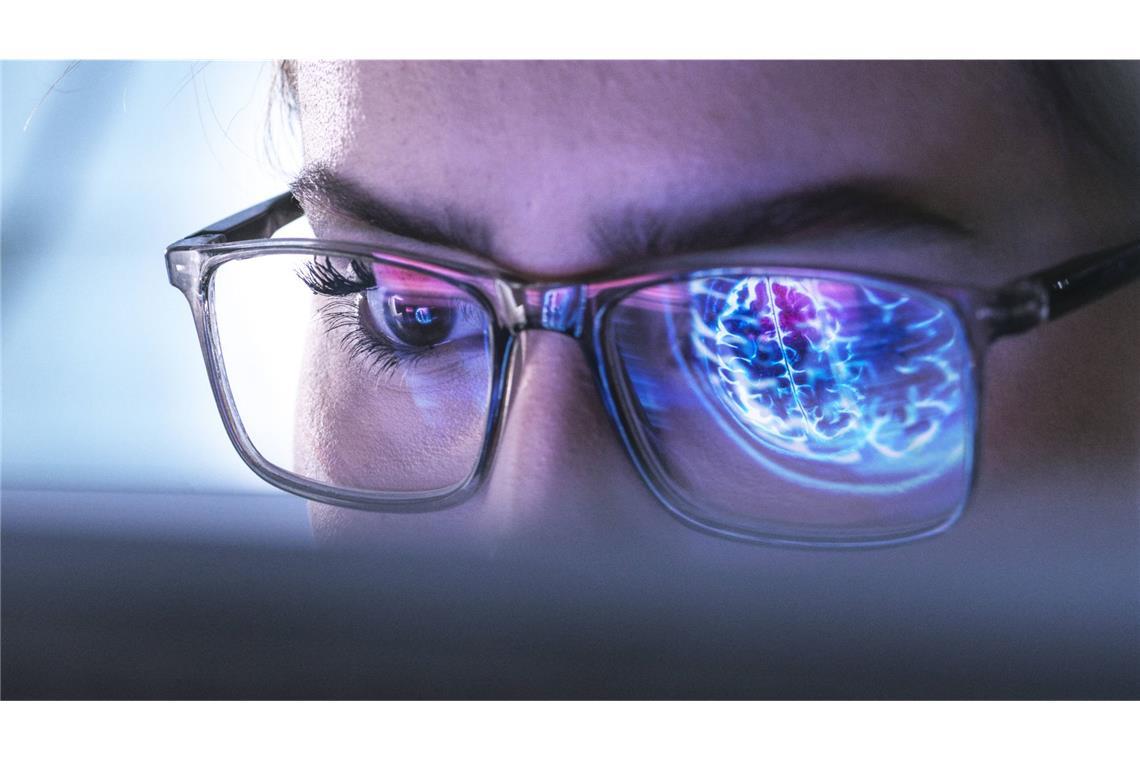
Ein Arzt untersucht mit Hilfe einer KI die Abbildung eines menschlichen Gehirns.
Von Rainer Pörtner
Es gibt diese wunderbare Szene in dem Buch und Filmklassiker „Die Feuerzangenbowle“, in der es um die Dampfmaschine geht. Der schrullige Physiklehrer Bömmel steht vor seiner Klasse und fragt in niederrheinischem Singsang. „Wo simmer denn dran? Aha, heute krieje mer de Dampfmaschin.“ Und dann beginnt Bömmel zu dozieren: „Also, wat is en Dampfmaschin? Da stelle mehr uns janz dumm. Und da sage mer so: En Dampfmaschin, dat is ene jroße schwarze Raum, der hat hinten un vorn e Loch. Dat eine Loch, dat is de Feuerung. Und dat andere Loch, dat krieje mer später.“
Am Beginn einer neuen Revolution
Wir werden nie erfahren, ob es das „später“ für diese Schüler gegeben hat. Immerhin dürften heutige Erwachsene aus ihrem eigenen Schulunterricht mitgenommen haben, dass es sich um eine Wärmekraftmaschine handelt: Sie verwandelt Dampfdruck in Bewegung – und revolutionierte mit dieser Fähigkeit einst die Wirtschaft und die Welt.
Vor der Dampfmaschine waren Wind, Wasser, Menschen- oder Tierkraft notwendig, um mechanische Energie zielgerichtet einzusetzen. Von nun an konnte dies unabhängig von Zeit und Ort geschehen: in Fabriken, auf Schiffen, in Lokomotiven. Die Dampfmaschine hat vor zweihundert Jahren die Art zu Produzieren umgekrempelt, sie war eine Schlüsseltechnologie für die Industrielle Revolution und damit für globale gesellschaftliche Veränderungen.
Heute stehen wir am Beginn einer neuen Revolution. Vieles spricht dafür, dass es diesmal die Künstliche Intelligenz ist, die unsere Welt grundlegend verändert. Worum geht es dabei im Kern? In Analogie zur Dampfmaschine könnte man sagen: die Künstliche Intelligenz verwandelt elektrische Energie in Know How, in Informationen, in Erkenntnis.
Stromverbrauch wie hunderttausend Haushalte
Wenn es nun um die Frage geht, wer in Sachen KI die Nase vorn hat, dann wird vor allem auf die Technik geschaut. Wer verfügt über die besten Computerprogramme, die pfiffigsten Algorithmen, die passenden Chips? Das ist auch alles wichtig. Aber es missachtet die zweite Komponente dieser neuen Technologie – die Energie.
Künstliche Intelligenz ist ein Stromfresser ganz neuer Dimension. Das maschinelle Lernen, also das Kernstück der KI, resultiert aus unzähligen Rechenoperationen. Rechenzentren mit spezialisierten KI-Chips benötigen deshalb ein Vielfaches der Energie älterer Rechenzentren. Einzelne KI-Rechenzentren verbrauchen heute so viel Strom wie hunderttausend Haushalte.
Die Internationale Energieagentur (IEA) sagt voraus, dass sich der Energieverbrauch der Rechenzentren schon bis zum Jahr 2030 weltweit mehr als verdoppeln wird – auf 945 bis 1400 Terrawattstunden. Das entspricht dem heutigen Stromverbrauch ganzer Industrieländer wie Japan.
KI-Firmen bauen sich eigenen Kraftwerke
Mal abgesehen davon, dass KI für einen deutlich erhöhten CO2-Ausstoß sorgt und die Eindämmung des Klimawandels zusätzlich erschwert, ist zu klären, woher der ganze Strom kommen soll und wie teuer er ist.
Führende KI-Unternehmen wie Microsoft, Google und Amazon bauen gerade für viele Milliarden Euro eigene Kraftwerke, um ihren Energiebedarf unabhängig von der öffentlichen Stromversorgung in den USA abzudecken. Sie investieren in das gesamte Spektrum der Energieerzeugung – von konventionell (Kohle, Gas, Atom) bis erneuerbar (Solar, Wind etc.). Aber es zeichnet sich schon ab, dass die Strompreise angesichts der übergroßen Nachfrage kräftig steigen werden. In vielen westlichen Staaten wird der schnelle Energieausbau ausgebremst durch veraltete Stromnetze, langwierige Genehmigungsverfahren, hohe Kosten und gesellschaftliche Widerstände etwa gegen die Atomkraft.
„Wettbewerb der Kilowatt“
Der größte Rivale der USA sieht sich deshalb im Vorteil. Die Chinesen arbeiten mit Hochdruck an KI-Systemen, die ähnliche Fähigkeiten wie die US-Konkurrenz haben bei deutlich kleinerem Energieverbrauch. Gleichzeitig bauen sie ihre Stromkapazitäten in ganz großem Stil aus. Viel Geld fließt in den Ausbau der Kernenergie, auch mit Reaktoren einer neuen Generation. Aber genauso investieren sie in Solar-, Wind- und Wasserkraft. Im Jahr 2024 hat China Kapazitäten für 356 Gigawatt aus erneuerbaren Energien geschaffen. Da können die USA und die Europäische Union nur staunen.
„Was einst als Wettstreit der Algorithmen galt, entwickelt sich zusehends zu einem Wettbewerb der Kilowatt“, sagt Jeffrey Wu, Geschäftsführer von MindWorks Capital in Hongkong. „Und China ist auf dem besten Weg, als Sieger daraus hervorzugehen.“
Mal schauen, ob er Recht hat. Das Wetteifern um die Dampfmaschine der Zukunft ist jedenfalls in vollem Gange.