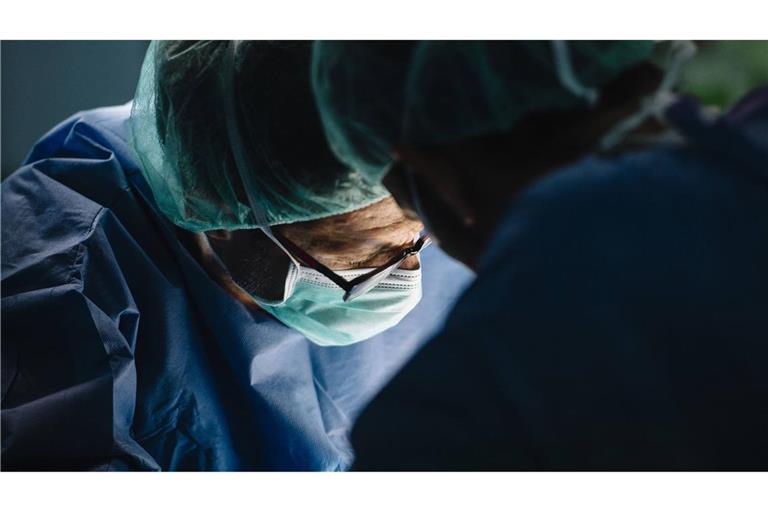Belastungsgrenzen der Erde
60 Prozent der Landflächen weltweit in kritischem Zustand
Eine Studie kartografiert detailliert und über Jahrhunderte die planetare Belastungsgrenzen der „funktionalen Integrität der Biosphäre“. Es ist schlimmer als befürchtet.

© mago/Pond5 Images
Weltweit sind die Böden, Grundlage menschlichen Lebens, mit giftigen Metallen belastet: 0,9 bis 1,4 Milliarden Menschen leben in Regionen mit einem erhöhten Risiko für die öffentliche Gesundheit und Ökosysteme
Von Markus Brauer
Er ist unter uns, unter den Feldern, die uns Nahrung schenken, unter dem Gras, auf dem wir laufen, unter den Bäumen, die unsere Atemluft filtern. Er scheint unerschöpflich und seit Urzeiten vorhanden. Die Rede ist vom Boden. Der Mensch tritt ihn mit Füßen, behandelt ihn wie Dreck, missbraucht ihn als Mülldeponie. Er wird vergiftet und versiegelt, er erodiert und wird weggeschwemmt.
Eine neue Studie zur Bodendegradation, geleitet vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) zusammen mit der Universität für Bodenkultur Wien, ist jetzt in der Fachzeitschrift „One Earth“ publiziert worden. Demnach sind 60 Prozent der globalen Landflächen schon außerhalb des lokal definierten sicheren Bereichs und 38 Prozent sogar in der Hochrisikozone.
More than half of the world’s land area is in a precarious state, according to a new study mapping the #PlanetaryBoundary of functional biosphere integrity - in spatial detail and across centuries. 38% of global land is already in the high-risk zone. https://t.co/nyd0ZDi8Jcpic.twitter.com/7mEJK6AkQw — Potsdam Institute for Climate Impact Research PIK (@PIK_Climate) August 15, 2025
Integrität der Biosphäre
Die funktionale Integrität der Biosphäre meint die Fähigkeit der Pflanzenwelt, zur Regulierung des Erdsystems beizutragen. Dazu muss die Pflanzenwelt in der Lage sein, durch Photosynthese genügend Energie zu gewinnen, um die Materialflüsse von Kohlenstoff, Wasser und Stickstoff aufrechtzuerhalten, welche die Ökosysteme und ihre vielfältig vernetzten Prozesse unterstützen. Und das trotz der heutigen massiven Eingriffe des Menschen.
Zusammen mit Artensterben und Klimawandel bildet die funktionale Integrität der Biosphäre den Kern des Analysekonzepts der Planetaren Grenzen zum sicheren Handlungsraum der Menschheit.
„Für die zivilisatorische Nutzung der Biosphäre gibt es enormen Bedarf – zur Ernährung, zur Rohstoffgewinnung und künftig auch zum Klimaschutz“, sagt Fabian Stenzel, Leitautor der Studie und Mitglied der PIK-Forschungsgruppe Sicherer Handlungsraum Landbiosphäre.
Schließlich wachse nach wie vor die menschliche Nachfrage nach Biomasse. Überdies würden viele im Anbau schnell wachsender Gräser oder Bäume zum Verfeuern mit Abscheiden und Speichern von CO₂ eine wichtige unterstützende Strategie zur Klimastabilisierung benötigen. „Es wird also noch wichtiger, die bereits bestehende Beanspruchung der Biosphäre regional differenziert und über die Zeit hinweg zu beziffern, um Überlastung zu erkennen. Dafür ebnet unsere Forschungsarbeit den Weg.“
Zwei Indikatoren messen Belastung und Risiko
Die Studie setzt an der jüngsten Aktualisierung des Planetare-Grenzen-Konzepts von 2023 an. „Das Konzept stellt nun die Energieflüsse aus der Photosynthese der weltweiten Vegetation klar in den Mittelpunkt der Prozesse, die zur Regulierung der planetaren Stabilität beitragen“, erklärt Wolfgang Lucht, Leiter der PIK-Abteilung Erdsystemanalyse und Koordinator der Studie. „Diese Energieflüsse treiben alles Leben an – aber die Menschen lenken einen beträchtlichen Teil davon für ihre eigenen Zwecke um und stören damit die dynamischen Prozesse der Natur.“
Die Belastung, die das im Erdsystem verursacht, lässt sich als Anteil der natürlichen Biomasse messen, den die Menschheit der Natur abverlangt: durch Abernten von Pflanzen, Pflanzenresten und Holz, aber auch die Verringerung der Photosynthese-Aktivität durch Landnutzung und Flächenversiegelung.
Die Studie ergänzt diese Messgröße um einen zweiten aussagekräftigen Indikator für die Integrität der Biosphäre: Eine Ökosystem-Risikokennzahl erfasst komplexe strukturelle Veränderungen in der Vegetation und in den Bilanzen von Wasser, Kohlenstoff und Stickstoff in der Biosphäre.
Vor allem Europa, Asien und Nordamerika betroffen
Gestützt auf das globale Biosphären-Modell LPJmL, das die Wasser-, Kohlenstoff- und Stickstoffströme täglich und in Arealen von einem halben Längen-/Breitengrad simuliert, liefert die Studie eine Bestandsaufnahme, für jedes einzelne Jahr seit dem Jahr 1600, basierend auf Veränderungen von Klima und menschlicher Landnutzung.
Die beiden Indikatoren für die funktionale Integrität der Biosphäre wurden vom Forschungsteam nicht nur berechnet, kartografiert und verglichen, sondern auch beurteilt: durch einen mathematischen Abgleich mit anderen Indikatoren, für die „Schmerzgrenzen“ schon definiert sind.
Am Ende wurde jedem Areal, jeweils bezogen auf die lokalen Toleranzgrenzen für Veränderungen des Ökosystems, ein Status zugewiesen: sicherer Handlungsraum, Bereich zunehmenden Risikos oder Hochrisiko-Bereich.
Bedenkliche Entwicklungen bereits seit 1600
- Die Modellrechnung zeigt in den mittleren Breiten bereits um das Jahr 1600 bedenkliche Entwicklungen.
- Im Jahr 1900 betrug der Anteil der weltweiten Landflächen, die den lokal definierten sicheren Bereich verlassen haben oder sogar in der Hochrisikozone lagen, 37 beziehungsweise 14 Prozent im Vergleich zu den 60 und 38 Prozent heute.
- Die Industrialisierung begann ihren Tribut zu fordern. Die Landnutzung wirkte sich viel früher auf den Zustand des Erdsystems aus als die Klimaerwärmung.
- Inzwischen ist diese Biosphäre-Belastungsgrenze auf fast allen Landflächen überschritten, in denen – in erster Linie in Europa, Asien und Nordamerika – die Vegetation stark verändert wurde, vor allem zugunsten der Landwirtschaft.
Impuls für internationale Klimapolitik
„Diese erste Weltkarte zum Überschreiten der Belastungsgrenze der funktionalen Integrität der Biosphäre, welche die menschliche Aneignung von Biomasse und die ökologischen Störungen anzeigt, ist aus wissenschaftlicher Sicht ein Durchbruch für ein besseres Gesamtverständnis der planetaren Grenzen“, konstatiert Johan Rockström, PIK-Direktor und einer der Co-Autoren der Studie.
Sie liefere zudem einen wichtigen Impuls für die weitere Entwicklung der internationalen Klimapolitik. Denn sie lenke den Blick auf den Zusammenhang, wie Biomasse und natürliche Kohlenstoffsenken zum Eindämmen des Klimawandels beitragen können. Rockström: „Die Regierungen müssen es als ein Gesamtthema behandeln: den umfassenden Schutz der Biosphäre zusammen mit den Klimaschutz.“