Mehr gemeinsam als man denkt
Gleiche Genvarianten: So ähnlich sind sich Mensch und Golden Retriever
Ob ein Hund ängstlich, lernbegabt oder faul ist, hängt auch von seinen Genen ab. Dabei wird der Charakter des Vierbeiners teilweise von den gleichen Genvarianten geprägt wie bei uns Menschen.
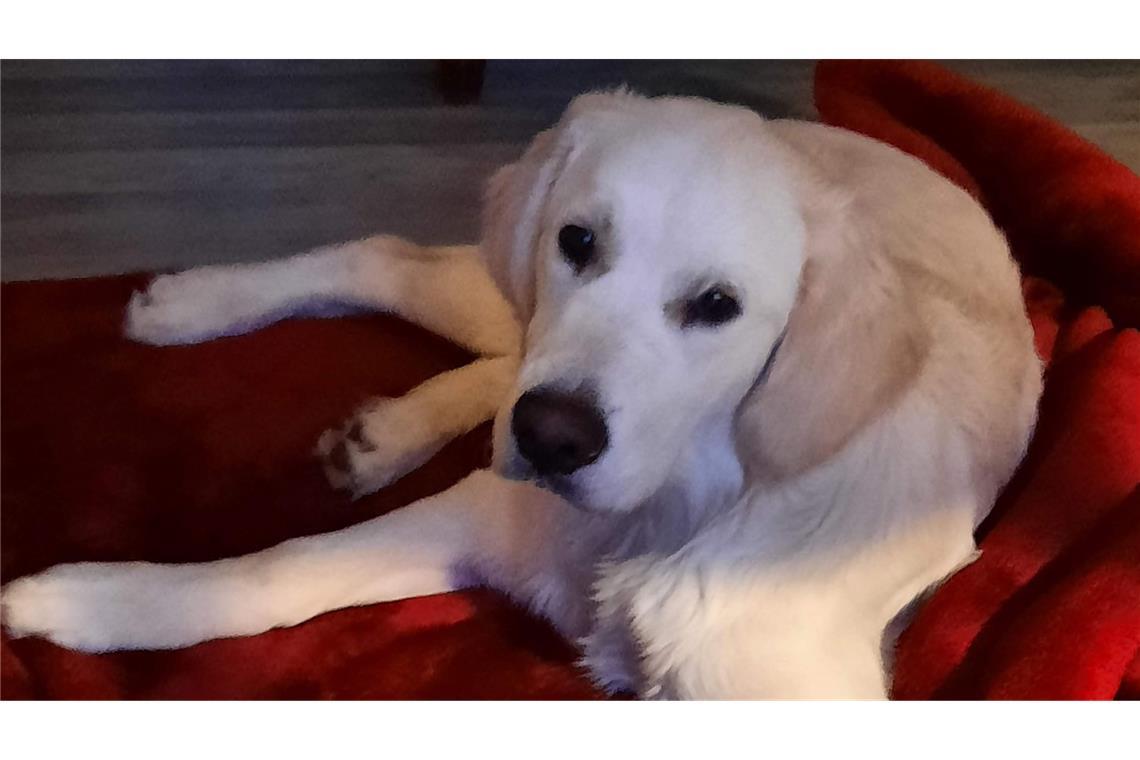
© Privat
Hunde erfüllen für Menschen verschiedene emotionale Rollen: als Spielgefährte, Begleiter, Kind-Ersatz, Mittel gegen Einsamkeit oder wegen ihrer bedingungslosen Treue.
Von Markus Brauer
Treuer Freund, bester Kumpel, Kind-Ersatz? Halter entwickeln oft ein sehr inniges Verhältnis zu ihren Hunden. Generell erfüllen Hunde für Menschen verschiedene emotionale Rollen: als Spielgefährte, Begleiter, Kind-Ersatz, Mittel gegen Einsamkeit oder bedingungslos treue Wesen.
Bester Freund des Menschen
Der Begriff „bester Freund des Menschen“ wurde übrigens erstmals im Jahr 1789 verwendet, als König Friedrich II. (der Große) von Preußen angeblich sagte: „Der einzige, absolute und beste Freund, den ein Mann in dieser selbstsüchtigen Welt hat, der einzige, der ihn nicht verraten oder verleugnen wird, ist sein Hund.“.
Von allen domestizierten Tieren sind Hunde die frühesten Begleiter des Menschen. Sie erfüllten viele praktische Funktionen, etwa als Hüte- oder Wachhunde. Schon früh war zudem ein emotionales Verhältnis entstanden.
Was Hunde-Fossilien aussagen
Lang ist es her, dass aus Wolfsrudeln die ersten Hunde domestiziert wurden. Aber wo geschah das zuerst - in Asien oder Europa? Nach derzeitigem Forschungsstand wurde der Hund wohl zweimal domestiziert: Er stammt demnach von zwei voneinander unabhängigen Wolfs-Populationen in Europa und Asien ab, die sich später vermischten. Darauf zumindest weisen Erbgutanalysen hin.
Forscher des Senckenberg Centre for Human Evolution and Palaeoenvironment an der Universität Tübingen haben die Anfänge der Domestizierung von Wölfen in Europa in einer Studie genauer untersucht – und sind zu überraschenden Ergebnissen gekommen. Sie untersuchten dafür mehrere Hunde-Fossilien aus der Gnirshöhle in Baden-Württemberg.
Vor 30.000 Jahren: Der Wolf wird um Haushund
In ihrer im Fachjournal „Scientific Reports“ veröffentlichten Analyse kommen sie zu dem Schluss, dass im Südwesten Deiutschlands vor 16.000 bis 14.000 Jahren der Übergang von Wölfen zu gezähmten Hunden stattfand.
"Wann genau die Domestizierung von Wölfen zu Haus- und Hütehunden erfolgte, ist aber nach wie vor unklar. Wissenschaftliche Schätzungen variieren zwischen etwa 15.000 bis 30 000 Jahren vor heute“, erklärt der Tübinger Forscher Chris Baumann. „Auch der Ort dieses Übergangs vom Wild- zum Haustier ist bislang nicht geklärt.“
Verbindender Effekt dank Kuschelhormon Oxytocin
Seit seiner Domestizierung ist kein anderes Tier ist so auf den Menschen eingestellt wie der Hund. Er erkennt unsere Stimmung, unsere Tonlage, unser Lächeln und kann sich sogar gedanklich in uns hineinversetzen.
Anders als ihre wölfischem Vorfahren sind Hunde genetisch darauf programmiert, anhänglich und verträglich zu sein. Eine weitere Genvariante der Hunde stärkt den verbindenden Effekt des Kuschelhormons Oxytocin – beispielsweise beim tiefen Augenkontakt mit uns.
Aber nicht jeder Hund ist gleich: Hundebesitzer wissen aus Erfahrung, wie individuell ihre vierbeinigen Gefährten sind, selbst innerhalb der gleichen Rasse. So gelten beispielsweise Golden Retriever generell als besonders gutmütig und gut trainierbar.
Doch wie lernfähig der einzelne Hund ist, wie gut er sich mit anderen Hunden verträgt, wie energiegeladen oder schreckhaft er ist, kann von Tier zu Tier sehr unterschiedlich sein.
Spurensuche im Golden-Retriever-Genom
Durch Erziehung lassen sich zwar bestimmte Verhaltensweisen des Hundes fördern oder minimieren. Grundlegende Charakterzüge aber bleiben unveränderlich. „Unterschiede in der emotionalen Reaktivität, Geselligkeit und anderen Verhaltensmerkmalen entstehen durch komplexe Wechselwirkungen zwischen genetischen und umweltbedingten Faktoren“, erläutern Enoch Alex von der University of Cambridge und seine Forscherkollegen in ihrer im Fachjournal
We may be more closely related to our canine companions than we realised… A study @PDN_Cambridge has found some of the same genes influence emotions and behaviour in both golden retrievers and humans. Chew over the study: https://t.co/uEMdJMCIn4pic.twitter.com/DJFBn1U31Q — Cambridge University (@Cambridge_Uni) November 25, 2025
„Proceedings of the National Academy of Sciences“ veröffentlichten Studie.
Welche Gene sind für das Verhalten des Vierbeiners maßgeblich? Die Forscher untersuchten das Genom von 1343 Golden Retrievern im Alter zwischen drei und sieben Jahren. Zusätzlich sollten die Besitzer einen umfangreichen Fragebogen zu Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen des tierischen Versuchsteilnehmers auszufüllen.
Dabei kamen zahlreiche Genvariationen zum Vorschein, die jeweils mit bestimmten Verhaltensweisen assoziiert waren.
Wie Herrchen und Frauchen, so der Hund
Das Ergebnis: Es zeigten sich weitreichende Übereinstimmungen zwischen Mensch und Hund. „Bei zwölf der 18 identifizierten Gene aus der genomweiten Assoziationsstudie bei Hunden fanden wir signifikante Assoziationen beim Menschen für psychiatrische, temperamentbezogene und kognitive Merkmale“, berichten die Wissenschaftler. „Dabei zeigte sich eine bemerkenswerte biologische Konvergenz.“
So beeinflusst etwa eine Variante im Gen ASCC3 bei Hunden, wie souverän sie sich gegenüber Artgenossen verhielten. Beim Menschen wird dieses Gen mit Charakterzügen wie Neurotizismus, Ängstlichkeit und Sensibilität in Verbindung gebracht.
Eine andere Variation im ROMO1-Gen fördert bei Hunden die Trainierbarkeit. Bei Homo sapiens ist diese Variante mit Intelligenz und emotionaler Sensibilität assoziiert. Dies ist laut Enoch Alex ein Hinweis darauf, dass auch bei Hunden das Training nicht nur ihre kognitive Leistungsfähigkeit anspricht, sondern auch eine emotionale Komponente hat.
Gemeinsame genetische Wurzeln
„Die Ergebnisse sind wirklich bemerkenswert. Sie liefern starke Hinweise darauf, dass Menschen und Golden Retriever gemeinsame genetische Wurzeln für ihr Verhalten haben“, erklärt Eleanor Raffan. „Die von uns identifizierten Gene beeinflussen häufig die emotionalen Zustände und das Verhalten beider Spezies.“
Enoch Alex ergänzt: „Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Genetik das Verhalten steuert und manche Hunde dazu prädisponiert, die Welt als stressig zu empfinden. Wenn ihre Lebenserfahrungen dies noch verstärken, könnten sie sich auf eine Weise verhalten, die wir als schlechtes Benehmen interpretieren, obwohl sie in Wirklichkeit nur verzweifelt sind.“
Nützlich für Tiermedizin und Humanmedizin
Auch Auswirkungen auf die tierärztliche Versorgung wären denkbar, beispielsweise bei ängstlichen Hunden. Wenn ihre Angst auf den gleichen genetischen Mechanismen beruhen wie bei uns Menschen, könnten für Menschen entwickelt, angstlösende Medikamente möglicherweise auch den Vierbeinern helfen.
Reziprok könnten Erkenntnisse zur Hunde-Psyche auch für die Humanpsychologie von Bedeutung sein. „Hunde in unserem Zuhause teilen nicht nur unsere physische Umgebung, sondern möglicherweise auch einige der psychologischen Herausforderungen, die mit dem modernen Leben verbunden sind“, resümiert Koautor Daniel Mills von der University of Lincoln. „Unsere Haustiere können deshalb ausgezeichnete Modelle für einige psychiatrische Erkrankungen des Menschen sein, die mit emotionalen Störungen einhergehen.“
Freundschaft zwischen Tier und Mensch
Freundschaft Wer sagt eigentlich, dass Freunde immer auf zwei Beinen gehen müssen und nur Menschen zu echter, tiefer Freundschaft fähig sind? „Freunde sind Individuen, die viel Zeit miteinander verbringen. Es geht bei Freundschaft um soziale Verträglichkeit, Toleranz und das Aktivieren des Beruhigungssystems“, sagt Kurt Kotrschal, emeritierter Biologe und Verhaltensforscher an der Universität Wien. Nach dieser Definition macht es überhaupt keinen Unterschied, ob der Freund dicht behaart ist, maunzt, bellt oder wiehert, wenn er sich freut und Liebesbekundungen einfordert.
Kumpane Unsere Stresssysteme würden durch angenehme soziale Kontakte deaktiviert, erklärt der frühere Leiter der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle für Ethologie in Grünau Verhaltensbiologe. Es gebe keinen signifikanten Unterschied zwischen menschlichen Freunden und Tieren – den sogenannten Kumpan-Tieren. „Wenn die Beziehung okay ist, entfalten sie bei beiden dieselben positiven Wirkungen auf Psyche und Physiologie. Gelegentlich sogar noch bessere, etwa weil man sich bei menschlichen Freunden davor hütet, sich zu blamieren.“
Empfindungen Tiere können, denken, fühlen und empfinden. Zumindest höhere Säugetiere verfügen über all das, was originäre Intelligenz ausmacht: Emotionalität, Erkenntnisvermögen, ein komplexes soziales Zusammenleben sowie echte Lernfähigkeit. Sie empfinden Freude und Trauer, sie nehmen Zuwendung und Schmerzen wahr, sie können Liebe empfangen und Liebe schenken.
Fürsorge „Alle Säugetiere sind wie der Mensch hauthungrig. Miteinander etwas tun, tolerant sein, das Ankurbeln von wechselseitiger Fürsorge – das machen Hunde und Katzen auch gegenüber dem Menschen. Da wird geleckt und geschleckt“, erklärt Kotrschal. Wenn eine Katze nach dem Putzen bei ihrem Herrchen gleich damit weitermacht, ist das eine „kätzische“ Art zu sagen: „Ich hab’ dich zum Schlecken gern. Du bist mein Freund.“
Beziehung Katzen und Hunde hätten ein fast identisches soziales Gehirn wie der Mensch, so der Biologe. Die grundlegenden Mechanismen zwischen den Spezies seien gleich. Deshalb sei auch anzunehmen, dass sie ähnlich wahrnehmen wie wir. „Wenn der Mensch einen Hund streichelt, gibt es bei beiden einen Ausstoß des Bindungshormons Oxytocin. Es handelt sich um eine sehr symmetrische Beziehung. Ich denke, das ist bei Katzen und Hunden nicht anders.“ „Aus biologischer Sicht ist das Verhältnis von Tier und Mensch eine echte Sozialpartnerschaft und Freundschaft“, betont Kotrschal. Und wie in einer menschlichen Freundschaft ist es ein Geben und Nehmen. „Wenn in einer menschlichen Beziehung der eine nur gibt und der andere nur nimmt, dann wird die Beziehung nicht ewig halten.“
Freundschaft „Jede Freundschaft ist einmalig“, betont Kotrschal. „Sie besteht nicht nur aus den Eigenschaften der beiden Partner, sondern darin, was zwischen den beiden entsteht. Jede Partnerbeziehung ist einzigartig – sowohl bei Tieren als auch bei Menschen.“ Irgendwann kommt der Tag, an dem man von seinem tierischen Freund Abschied nehmen muss. „Das ist so, wie wenn man einen Menschen verliert“, weiß der Hundebesitzer aus eigener Erfahrung. Und wie in menschlichen Beziehungen sei es nicht sehr klug, sich gleich danach den nächsten Partner anzulachen und zu versuchen, die verlorene Partnerschaft mit einem neuen Partner zu leben. „Das läuft meistens schief.“



