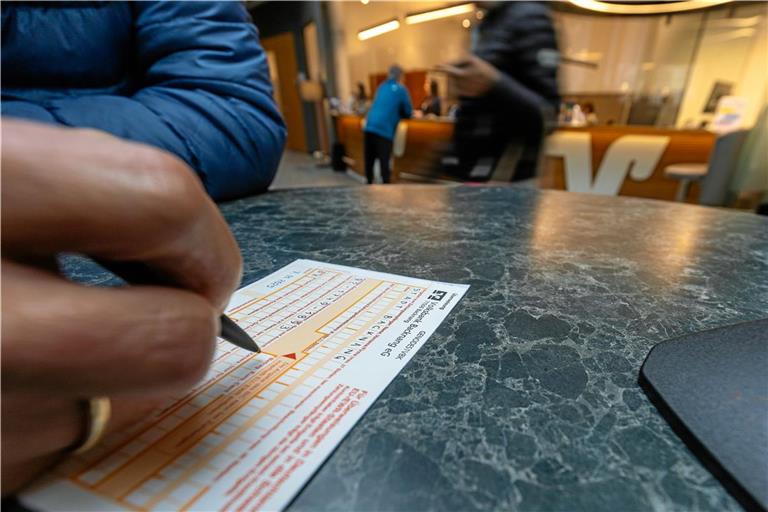Mehr Lebensraum für die Gelbbauchunke im Rems-Murr-Kreis
Die stark gefährdete Amphibienart hat sehr spezifische Anforderungen an ihre Laichgewässer. Diese sollen nun systematisch im ganzen Land geschaffen werden. Zur Vorstellung des neuen Konzepts kommt Minister Peter Hauk in die Region.

Die gelben Flecken am Bauch der Unke sind namensgebend. Fotos: privat
Von Lorena Greppo
Rems-Murr. Im Wald ist die Gelbbauchunke gut getarnt. Die markanten gelben Flecken verstecken sich an ihrem Unterbauch. Wer nicht weiß, wo er nach ihr zu suchen hat, wird sie vermutlich nicht zu Gesicht bekommen. Dabei kommt die Amphibienart im Rems-Murr-Kreis flächendeckend vor, erklärt Martin Röhrs, Leiter des Forstbezirks Schwäbisch-Fränkischer Wald. Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn die Gelbbauchunke steht auf der Roten Liste der gefährdeten Arten (siehe Infotext) und ist streng geschützt. Ihr Schutzstatus „ist vergleichbar mit Wolf, Luchs und Bär“, führt der Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Peter Hauk aus. Er ist zu Gast im Staatswald in der Region, um gemeinsam mit Forst BW das neue Vorsorgekonzept für die Gelbbauchunke vorzustellen. Dieses ist bislang bundesweit einmalig und wurde von Expertinnen und Experten entwickelt, damit die Tiere geeignete Lebensräume im Wald finden.

Forstrevierleiter Hans-Joachim Bek (rechts) erklärt den Anwesenden um Minister Peter Hauk (links) die Anforderungen an einen geeigneten Lebensraum für Gelbbauchunken.
Schon vor etwa zehn Jahren haben die Förster im hiesigen Forstbezirk die Gelbbauchunke in den Blick genommen und Ersatzhabitate angelegt, führt Röhrs aus. Denn die Tierart hat sehr spezifische Anforderungen. Das Gewässer müsse frisch sein, sonst kommen dort auch Fressfeinde wie der Gelbrandkäfer oder Libellenlarven vor. Diese verhindern, dass der Nachwuchs der Unken überlebt. Deshalb sind für die Unken neu entstandene Gewässer, beispielsweise Fahrspuren, die bei der Holzernte entstehen und in denen das Wasser erhalten bliebt, ideale Lebensräume. Zusätzlich wurde auch mit Baggern noch Löcher am Wegrand ausgehoben, die den Amphibien ebenfalls taugen. Das Vorgehen ist also nicht neu, doch ab sofort wird in jedem Forstbezirk eine Sollzahl von Habitaten formuliert.
Nicht alle sehen die Fahrrinnen gerne
Felix Reining, Vorstand von Forst BW, erläutert: „Ein Habitat besteht aus mehreren Gewässern, meistens sind es etwa vier Pfützen.“ Die Försterinnen und Förster im Staatswald suchen die Lebensräume der Gelbbauchunken gezielt auf und kartieren sie. Reichen die durch die Holzernte erzeugten Habitate nicht aus, werden zudem künstliche angelegt. Diese Aufgabe begleitet die Beschäftigten von Forst BW ständig, denn die Unken brauchen eben immer wieder neue Pfützen.
Die Thematik ist auch nicht ohne Brisanz, wie Reining erläutert. „Die Förster sind da in einer Zwickmühle.“ Sie müssten nämlich auch den Anforderungen an den Bodenschutz, den Zertifizierungsstandards sowie den Erwartungen der Öffentlichkeit gerecht werden. Und diese fordern eine unberührte Natur, in der die Harvester eben keine Fahrrinnen hinterlassen. Auch deshalb sei die Öffentlichkeitsarbeit wichtig. Unter anderem wird in den hiesigen Wäldern mit Hinweisschildern auf die Ersatzhabitate für die bedrohte Gelbbauchunke aufmerksam gemacht.
Im Forstbezirk Schwäbisch-Fränkischer Wald müssen laut Vorsorgekonzept etwa 40 Ersatzhabitate vorgewiesen werden, erklärt Hans-Joachim Bek, Leiter des Reviers Reichenberg. Das sei an sich kein Problem. Allerdings werden und sind schon jetzt anhaltende Trockenperioden im Verlauf des Klimawandels ein großes Problem. „Ich habe erst gestern einen Kontrollgang gemacht – es war verheerend“, berichtet Bek. Viele der Pfützen seien ausgetrocknet, der Laich der Unken sei eingegangen. So werde es schwierig mit der Reproduktion.
Die Zahlen sind deutlich zurück gegangen
Bek hat auch bei der Kartierung der Landesanstalt für Umwelt in Baden-Württemberg mitgeholfen. Das Ergebnis sei besorgniserregend gewesen: „Es gibt eine ganz deutliche Abnahme, die Zahlen sind stark zurückgegangen.“ Dabei hat die Gelbbauchunke keine wirklichen Fressfeinde, denn die Amphibien sondern bei Gefahr giftige Sekrete ab. Doch das hilft nicht immer. „Ein großes Problem ist dagegen der Waschbär geworden“, erläutert Martin Röhrs. Die findigen Tiere schaffen es, die Unken zu häuten und so den Verzehr des Giftsekrets zu vermeiden.
Um den Bestand der gefährdeten Amphibienart zu erhalten, ist das Vorsorgekonzept von Forst BW voraussichtlich nicht genug, das weiß auch Vorstand Felix Reining. Denn nur etwa ein Viertel der Waldfläche im Land ist Staatswald. „Wir allein können die Unke nicht retten. Aber wir können vorangehen, ein gutes Beispiel abgeben und einen Beitrag leisten“, sagt er. Nach fünf Jahren soll das Konzept evaluiert werden. Wolle man die Vorgehensweise dann auf kommunale Wälder übertragen, sei eine landesweite Verordnung notwendig. Minister Hauk stellt immerhin eine Aufstockung der Stellen für den Forst in Aussicht. Die Bedeutung des Artenschutzes habe man durchaus erkannt. „Wenn wir bestimmte Arten im Wald erhalten wollen, müssen wir aktiv was für sie tun“, betont er.
Merkmale Die Gelbbauchunke (Bombina variegata) ist ein kleinerer Froschlurch, der eine Größe von rund dreieinhalb bis fünf Zentimetern erreichen kann. Die Oberseite ist graubraun gefärbt und mit flachen Warzen besetzt. Die Unterseite ist graublau bis schwarzblau gefärbt und weist ein auffallendes gelbes Fleckenmuster auf. Die Gelbbauchunke besitzt herzförmige Pupillen.
Verbreitung Die Gelbbauchunke ist eher eine Art des Berg- und Hügellands im mittleren und südlichen Europa. Sie kommt hauptsächlich im Süden und in der Mitte Deutschlands vor. Die nördlichsten bekannten Vorkommen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen sind stark zurückgegangen und akut vom Aussterben bedroht.
Lebensraum Die Gelbbauchunke besitzt eine enge Bindung an den Lebensraum Wasser. Ursprünglich war die Art ein typischer Bewohner der Bach- und Flussauen, wo sie die im Zuge der Auendynamik entstandenen Gewässer besiedelte. Als Ersatzlebensräume bevorzugt die Gelbbauchunke temporäre Kleinstgewässer wie Traktorspuren, Pfützen und kleine Wassergräben, die meist vegetationslos und somit frei von konkurrierenden Arten und Fressfeinden sind. Durch die schnelle Erwärmung der Kleingewässer ist eine schnelle Entwicklung des Laichs und der Larven gewährleistet. Man findet diese Pionierart heute häufig in Steinbrüchen oder Kiesgruben sowie auf Truppenübungsplätzen.
Fortpflanzung Ab April beginnt die Fortpflanzungszeit der Gelbbauchunken. Die Weibchen heften in geringer Wassertiefe pro Laichakt zwei bis 30 Eier in lockeren Klümpchen an Pflanzenteile ab.
Gefährdung Die Zerstörung oder Beeinträchtigung von Kleingewässern durch Zuschüttung oder Eintrag von Müll, Dünger und Umweltgiften gefährdet die Gelbbauchunke.
Schutzstatus Europaweit ist sie geschützt nach der FFH-Richtlinie (Anhang II und IV) und „streng geschützt“ gemäß Bundesnaturschutzgesetz. Streng geschützte Arten dürfen nicht gefangen, verletzt oder getötet werden. Außerdem ist es verboten, sie durch Aufsuchen ihrer Lebensstätten zu beunruhigen.Quelle: Nabu