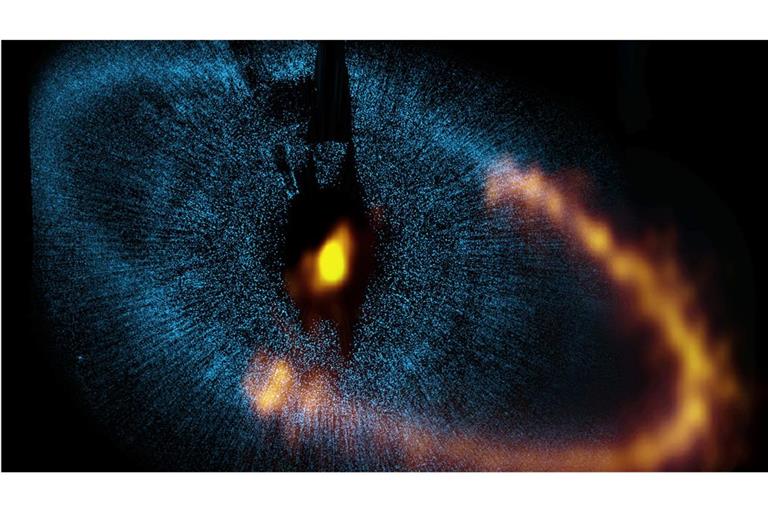Behandlung bei Stimmenhören
Neue Behandlungsmethode für Menschen mit Schizophrenie erfolgreich
Forscher der Universität Tübingen konnten zeigen, dass die Transkranielle Magnetstimulation eine wirksame Möglichkeit ist für Menschen, die unter auditorischen Halluzinationen leiden.

© IMAGO/YAY Images
Die Lebensqualität von Menschen, die unter Schizophrenie leiden und Stimmen hören, ist häufig erheblich eingeschränkt. Forscher haben nun eine wirksame Therapiemethode gefunden.
Von Nina Ayerle
Stimmen zu hören, ist für viele Betroffene äußerst belastend. Vor allem Menschen mit Schizophrenie leiden unter diesem Symptom. Häufig sind diese Stimmen, die Betroffene nur in ihrem Kopf hören, bedrohlich oder befehlend. Im Vordergrund steht bei der Behandlung bisher eine Kombination aus Medikamenten wie Antipsychotika und einer Psychotherapie. Allerdings haben vor allem entsprechende Medikamente teils erhebliche Nebenwirkungen und häufig nicht ausreichend wirksam.
Forscher um den Tübinger Psychiater Christian Plewnia haben nun in einer großangelegten Studie mit sieben anderen deutschen psychiatrischen Universitätskliniken untersucht, inwieweit die Transkranielle Magnetstimulation (TMS) eine wirksame Therapiemöglichkeit sein kann, für Menschen, die Stimmen hören. Die Ergebnisse der Untersuchung, die in der Fachzeitschrift „The Lancet Psychiatry“ veröffentlicht wurden, sind vielsprechend. „Die TMS bietet Betroffenen eine neue, wirksame und gut verträgliche Therapiemöglichkeit über Medikamente und Psychotherapie hinaus an“, sagt Plewnia, Professor am Zentrum für Hirnstimulation an der Universitätsklinik Tübingen für Psychiatrie und Psychiatrie in Tübingen.
Die Lebensqualität kann verbessert werden
Er bewertet die Ergebnisse sogar als „Meilenstein in der Behandlung von Menschen mit auditorischen Halluzinationen“. Nicht nur könne sie besser an die individuellen Bedürfnisse von Betroffenen angepasst werden, es könne auch die Lebensqualität der Menschen erheblich verbessern.
Die Transkranielle Magnetstimulation ist ein nicht-invasives Verfahren, bei dem mittels Magnetfelder gezielt Hirnregionen von außen durch den Schädel stimuliert werden. Bei Patienten, die Stimmen hören, werden dabei gezielt die Bereiche im Gehirn stimuliert, die für die Sprache und Sprachverstehen zuständig sind. Bisher habe es noch keine ausreichend große Studie gegeben, die belege, dass die Behandlung wirke, so Plewnia.
An der Studie haben 138 therapieresistente Erwachsene im Alter von 18 bis 65 Jahren, die von Schizophrenie betroffen sind und hartnäckig unter Stimmenhören leiden, teilgenommen. Die Studie fand an sieben Universitätskliniken in Deutschland statt. Über drei Wochen bekamen die Teilnehmenden entweder 15 Sitzungen mit der Magnetstimulation oder eine Scheinbehandlung (Placebo). Verwendet wurde eine Variante der TMS – die sogenannte kontinuierliche Theta-Burst-Stimulation (cTBS) –, die eine besonders schnelle und wirkungsvolle Behandlung ermöglichen soll.
Die aktive cTBS führte nach drei Wochen zu einer signifikant stärkeren Reduktion auditiver Sprachhalluzinationen als die Schein-cTBS. Die häufigsten Nebenwirkungen, die in beiden Gruppen aufgetreten sind, waren Kopfschmerzen oder Schwindel.
Die Behandlung wäre eine nebenwirkungsarme Alternative
Die Studie ist die weltweit erste dieser Größenordnung. Ihre positiven Ergebnisse erweitern damit die therapeutischen Möglichkeiten in der Behandlung des Stimmenhörens bei Schizophrenie über Medikament und Psychotherapie hinaus, so die Forscher.
Schizophrenie ist eine psychische Störung, die laut dem Diagnosehandbuch DSM-5 durch einen Verlust des Realitätsbezugs (Psychose), durch Halluzinationen wie gewöhnlich Hören von Stimmen, Wahnvorstellungen, Denkstörungen und abnormes Verhalten, einen verminderten Ausdruck von Gefühlen, Antriebsmangel, eine Abnahme geistiger Funktionen und Beeinträchtigungen im gesellschaftlichen und beruflichen Leben und bei der Selbstversorgung einhergeht.
Weder die Ursache noch der Mechanismus der Schizophrenie sind im Detail bekannt, der heutige Stand der Forschung spricht für eine Kombination aus erblichen und umweltbedingten Faktoren, bestimmte externe Faktoren, wie z. B. Lebenssituationen mit großem Stress oder Substanzgebrauch, Auslöser sein können.
Familien-, Adoptions- und Zwillingsstudien weisen darauf hin, dass die Anfälligkeit, für Schizophrenie zumindest zum Teil auf genetischer Veranlagung beruht. So nimmt die Wahrscheinlichkeit an Schizophrenie zu erkranken, mit steigendem Verwandtschaftsgrad zum Erkrankten zu. Sind beide Eltern an Schizophrenie erkrankt, liegt das Schizophrenie-Risiko für ihr Kind bei circa 40 Prozent. Auch bei Zwillingen ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass beide Geschwister erkrankt sind. Sie liegt bei zweieiigen Zwillingen bei ca. 15 Prozent, bei eineiigen Zwillingen bei etwa 50 Prozent.
Die Erkrankung tritt häufig bereits in jungen Jahren auf
Schizophrenie kommt häufiger vor als die Alzheimer-Krankheit und multiple Sklerose. An Schizophrenie erkranken in der Regel junge Menschen, häufig zwischen dem 20. und 25. Lebensjahr. Die Erkrankung kann zu lebenslanger Behinderung und Stigmatisierung führen.
Entgegen der landläufigen Meinung besteht bei Personen mit Schizophrenie nur ein leicht erhöhtes Risiko für gewalttätiges Verhalten. Gewaltandrohung und kleinere aggressive Ausbrüche sind viel häufiger als ernsthaft gefährliches Verhalten.