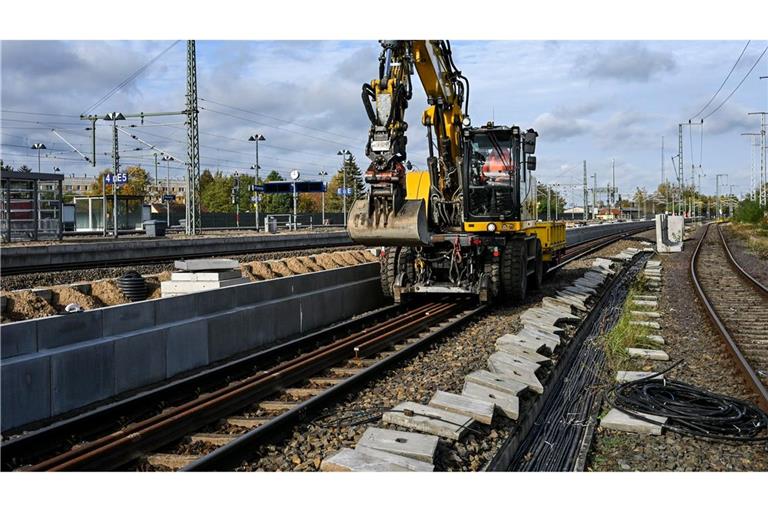Entwaldung
Sinnvoller Umweltschutz oder bloßes Bürokratiemonster?
Die EU will die Rodung von Wäldern stoppen und hat eine Entwaldungsverordnung verabschiedet. Doch Waldbesitzer und Sägewerkbetreiber laufen Sturm gegen diesen Plan.

© imago/Rene Traut
Die Dokumentationspflichten der EU im Rahmen des Green Deal treibt die Waldbauern auf die Palme.
Von Knut Krohn
Immer wieder klingelt bei Manuel Echtle das Telefon. Eine neue Maschine zur Holzverarbeitung läuft nicht, wie sie soll. Der 57-Jährige lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, gibt eine kurze Anweisungen und legt auf. „Wir haben gute Leute, wir bekommen das hin“, sagt er. Seit vier Generationen betreibt seine Familie das Sägewerk in der kleinen Schwarzwaldgemeinde Nordrach, Manuel Echtle hat als Geschäftsführer im Lauf der Jahre einen modernen Betrieb daraus gemacht. Das gilt auch für den genau getakteten Arbeitsablauf: Wenn ein Auftrag einläuft, muss er ohne große Zeitverzögerung abgearbeitet werden. Da kann der Ausfall einer Maschine ziemlich an den Nerven zehren.
Aber mit solchen Problemen kann Manuel Echtle umgehen, da er vor Ort die Lösung selbst in der Hand hat. Wesentlich mehr Sorgen bereitet ihm, was aus dem fernen Brüssel auf den Betrieb zukommt. Denn Ende 2025 soll die sogenannte Entwaldungsverordnung in Kraft treten. Die verpflichtet Unternehmen dazu, bei Holz, Kakao, Kaffee, Palmöl, Rindfleisch, Leder und Kautschuk sowie daraus hergestellten Produkten die Herkunft lückenlos zu dokumentieren. Ziel ist es, die Rodung von Wäldern zu stoppen.
„Gut gemeint, aber schlecht gemacht“
Das sei eine unterstützenswerte und wichtige Idee, betont Manuel Echtle, schiebt dann aber nach: „So, wie es die EU umsetzen will, ist es vielleicht gut gemeint, aber sehr schlecht gemacht.“ Vor allem für kleine und mittlere Betriebe ohne große Verwaltungsabteilung bedeute die geplante Dokumentationspflicht einen ungeheuren bürokratischen Aufwand. Bei ihm kämen fast wöchentlich Waldbauern vorbei, um nachzufragen, wie die neuen Regeln umgesetzt werden müssten. „Da herrscht bei allen eine große Verunsicherung“, sagt Echtle.
Unterstützung bekommen die Sägewerkbetriebe von den Waldbesitzern. Die geplante EU-Verordnung mache für „Deutschland keinen Sinn“, sagt Andreas Täger, Geschäftsführer Waldbesitzervereinigung Westallgäu. Er betont, dass „wir bereits sehr strenge Beschränkungen für die Umwandlung von Wald in landwirtschaftliche Fläche haben und Entwaldung de facto nicht stattfindet“. Im Gegenteil: die Bundeswaldinventur habe gezeigt, dass „die Waldflächen in Deutschland mehr werden, nicht weniger“.
Eine komplizierte Prozedur bei der Holzernte
Dann beschreibt Täger, die Prozedur, die beim Fällen von Bäumen in Zukunft durchlaufen werden muss. „Konkret heißt das, dass man vor jeder Maßnahme bei der EU anmelden muss, wer wo was macht – zum Beispiel Brennholz, Stammholz oder Holzpfähle.“ Jedes Mal müsse die Menge und die Baumarten mit ihrem botanischen und deutschen Namen angegeben werden. „Erst wenn der Waldeigentümer das getan hat, bekommt er eine Referenznummer und Prüfnummer und darf das Holz in Verkehr bringen.“ Dieser Datenwust wird dann bei der Weiterverarbeitung an das Sägewerk übergeben, das dann damit arbeiten muss.
Wegen des drohenden bürokratischen Aufwandes regt sich auch in anderen EU-Staaten Widerstand. Eine der Kernforderungen lautet, eine sogenannte Null-Risiko-Kategorie einzuführen, die im Moment nicht vorgesehen ist. Das heißt, in Ländern mit einem geringem Entwaldungsrisiko – zu denen auch Deutschland zählt – sollte anerkannt werden, dass die bestehenden nationalen Systeme ausreichend robust sind, um die Einhaltung der Entwaldungsverordnung nachweislich zu gewährleisten. Damit würden die von Brüssel geforderten Berichtspflichten weitgehend wegfallen. Unterstützt wird die Forderung von der Bundesregierung. Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) äußerte sich Ende Mai beim EU-Agrarministerrat in Brüssel zufrieden, dass „eine breite Mehrheit im Rat mein Ziel einer Null-Risiko-Kategorie teilt“. Aus dem Ministerium heißt es, dass nun entsprechende Vorschläge erarbeitet und in Brüssel eingereicht würden.
Umweltschützer fürchten Schlupflöcher
Doch der Aufschrei bei den Umweltschützern ist groß, sie befürchten durch das Einrichten einer neuen Kategorie die Schaffung von Schlupflöchern und einen weiteren Abbau von bereits festgezurrten EU-Umweltstandards. Jutta Paulus, Europaparlamentarierin von den Grünen, erklärte im Mai während der erbitterten Debatten über die neue Verordnung: „Getarnt als Bürokratieabbau führen die Konservativen einen Kulturkampf gegen die Natur, Umwelt und gegen alles, was nur wie Klimaschutz aussieht.“ Sie warnt, „die pauschalen Ausnahmen kämen einem Freifahrtschein für Waldzerstörung gleich und stehen im direkten Widerspruch zu den Zielen des europäischen Green Deal.“
Die Standards werden zurückgeschraubt
Solche scharfen Wortmeldungen lassen erahnen, dass es in diesem Fall um mehr geht als das geplante EU-Gesetz gegen Abholzung. Die Grünen befürchten, dass die Konservativen gezielt daran arbeiten, den bereits beschlossenen Green Deal insgesamt auszuhöhlen. Der Umbau Europas zu einem klimaneutralen Kontinent stand in den vergangenen fünf Jahren noch ganz oben auf der EU-Prioritätenliste. Doch die konservative Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP), der auch CDU und CSU angehören, hat im Juni 2024 die Europawahl auch mit dem Versprechen an ihre Wähler gewonnen, zentrale Forderungen des Green Deal zurückzuschrauben. In der Landwirtschaft wurden nach massiven Bauernprotesten bereits weitreichende Erleichterungen in Sachen Umweltschutz beschlossen.
Nichts deutet darauf hin, dass sich die Stimmung in Brüssel wesentlich entspannen wird – im Gegenteil. Denn der Green Deal sieht vor, dass im Jahr 2026 ein erstes Fazit der Gesetzgebung gezogen wird. Im Rahmen dieser sogenannten Revisionsklauseln könnte das Klimapaket an zentralen Stellen noch einmal aufgeschnürt und entschärft werden.