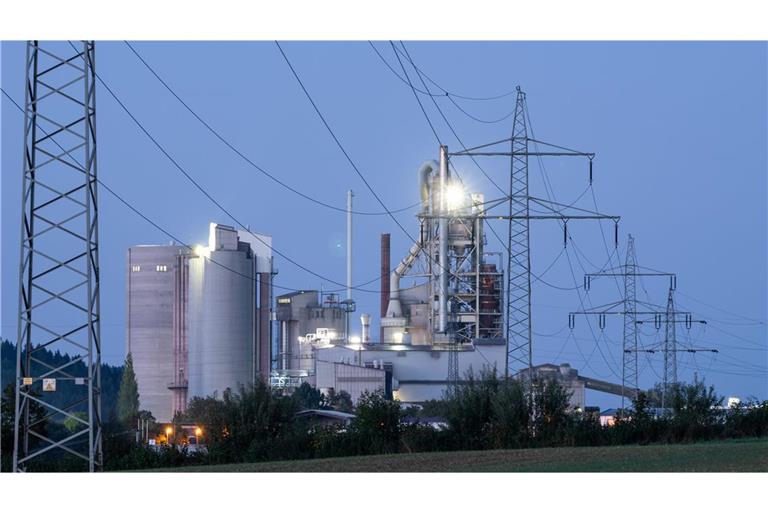Tiernamen: Bello und Mieze sind out
Für viele Menschen sind Haustiere vollwertige Familienmitglieder – Das spiegelt sich auch in der Namensgebung wider
Ob auf dem Spielplatz ein Kind oder ein Hund gerufen wird, lässt sich häufig nicht unterscheiden. Die Hitlisten der Namen für Kinder und Tiere ähneln sich zunehmend. Was steckt dahinter?
Stuttgart/Hannover „Das letzte Kind hat Fell“ ist ein unter Tierärzten verbreiteter Spruch, das lässt sich auch an den populärsten Namen für Katzen und Hunde ablesen. „Mieze und Bello sind nicht angesagt“, meldete jüngst das Haustier-Register Tasso. Wieder einmal führt bei den Hündinnen Luna die Namens-Hitliste 2018 an, gefolgt von Bella und Emma. Katzen wurden demnach am häufigsten Lilli/Lilly, Luna und Lucy genannt. Beliebte Tiernamen finden sich auch in den Top Ten der Mädchennamen.
Die innige Verbindung der Deutschen zu ihren Vierbeinern ist auch wissenschaftlich untersucht worden. Laut einer Befragung an der Kleintierklinik der Tierärztlichen Hochschule Hannover halten mehr als 90 Prozent ihren Hund oder ihre Katze für ein „vollwertiges Familienmitglied“. Knapp die Hälfte bezeichnet das Tier sogar als „Kind-Ersatz“.
„Die ursprünglichen Hauptfunktionen der Haustiere fallen weg“, sagt Peter Kunzmann, Professor für Ethik in der Tiermedizin. So gehe es bei der Katze nicht mehr darum, Nager fernzuhalten. Hunde würden im Privaten auch nur noch selten zum Schutz von Haus und Hof eingesetzt.
Die beliebtesten Namen für Rüden unterscheiden sich deutlicher von den Top Ten der Jungennamen. Hier steht Balu/Balou (der Bär aus dem „Dschungelbuch“) ganz oben, gefolgt von Buddy, also Kumpel, und Charlie/Charly. Aber auch die ebenso für Kinder tauglichen Bruno (Platz 6) und Max (Platz 10) tauchen auf. Bei den Katern hat Leo den langjährigen Spitzenreiter Felix verdrängt.
Das Register Tasso erfasst insgesamt 9,3 Millionen Heimtiere. Im vergangenen Jahr wurden 312 500 Katzen und 390 200 Hunde neu angemeldet. Dass ihre Namensgebung der Mode unterliegt, beweist ein Blick in die Tasso-Listen aus der Zeit vor 1990. Beliebt bei Hündinnen waren damals Susi, Lady, Anka, Trixi, Senta, Cindy, Cora, Tina, Asta und Jenny. Weibliche Katzen hießen oft Minka, Susi, Muschi, Mausi, Mohrle, Pussy, Tiger, Lisa, Micky oder Mieze.
Wenn Hunde- und Katzenbesitzer mit ihren Tieren sprechen, nutzen die meisten von ihnen unbewusst eine betontere, höhere Sprachmelodie. Warum das so ist und ob Tiere darauf stärker reagieren als auf normal akzentuiertes Sprechen, haben Forscher von der City University of New York in einer Studie untersucht. Das Ergebnis für Hunde: Welpen reagieren stärker auf das menschliche „Hundesprech“, ausgewachsene Hunde weit weniger bis gar nicht.
Menschen sprechen mit ihrem Haustier häufig wie mit einem Baby. Sie wechseln in eine piepsige Tonlage und reden besonders deutlich, berichten die Wissenschaftler in den „Proceedings B“ der britischen Royal Society. Das passiere bei Hunden aller Altersklassen, aber nur Welpen reagierten besonders aufmerksam darauf.
Die US-Forscher fanden heraus, dass die Benutzung der Babysprache vor allem zur Verständigung mit einem Gegenüber dient, das nicht sprechen kann oder die Sprache nur schlecht versteht. Das Expertenteam hatte 30 Frauen Bilder von Welpen, ausgewachsenen und alten Hunden gezeigt und sie gebeten, sich mit einem typischen Satz an die Foto-Gefährten zu wenden: Etwa: „Hallo, Süßer, komm her, guter Junge, so ist’s fein.“ Die Forscher zeichneten das Gesagte auf, um die Sprachmerkmale später genauer zu analysieren.
Dabei zeigte sich, dass die Versuchspersonen Hunde aller Altersstufen so anredeten wie Babys. Bei Welpen war die Stimmlage besonders hoch. Und: Es waren später vor allem die Welpen, die auf das kindgerechte Gesäusel aufmerksam reagierten. Sie wendeten sich rascher den Lautsprechern zu, näherten sich ihnen schneller und widmeten ihnen mehr Aufmerksamkeit als ältere Hunde. Diese sprangen auf die Babysprache nicht besonders an. Womöglich hätten sie gelernt, menschliche Laute, die nicht direkt von Herrchen oder Frauchen kommen, weitgehend zu ignorieren, erklärten die Forscher dieses Verhalten.
Welpen und Kitten lösen genauso wie Menschenbabys den Ach-wie-süß-Effekt („Cuteness factor“) aus. Forscher der Universität Bern haben herausgefunden, dass bei der Wahrnehmung von Niedlichkeit immer der gleiche Mechanismus im Gehirn abläuft. Große runde Stirn, kugelige tief sitzende Augen, ein kleines Kinn und Stupsnase wecken in uns Beschützerinstinkte und ein fürsorgliches Verhalten. Und: Was niedlich ist, beurteilen fast alle Menschen auf der Welt gleich, stellten die Berner Forscher fest. Der Verhaltensforscher Konrad Lorenz prägte hierfür den Begriff Kindchenschema.