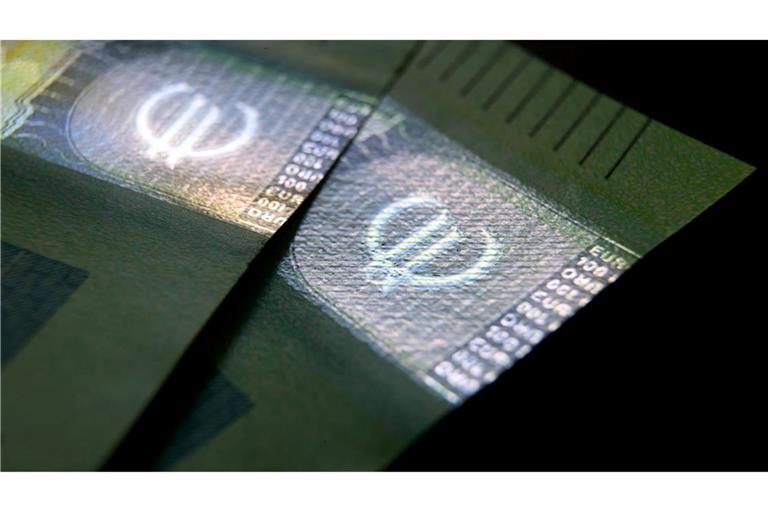Holocaust-Gedenktag am 27. Januar
Warum ist das Erinnern an den Holocaust weiter wichtig?
Am 27. Januar ist der Holocaust-Gedenktag. Aber was sagt er uns und vor allem der jungen Generation heute noch? Antworten von Menschen, die ihr Leben dem Thema gewidmet haben.

© picture alliance / dpa
Kinder im KZ Auschwitz-Birkenau bei ihrer Befreiung durch sowjetische Truppen im Januar 1945
Von Thomas Faltin
Sie sind für Hans-Joachim Lang fast zu Freunden geworden, obwohl sie seit mehr als 80 Jahren tot sind: Der frühere Journalist aus Tübingen forscht seit mehr als 40 Jahren über 86 Männer und Frauen, die der Straßburger Medizinprofessor August Hirt im KZ Natzweiler vergasen ließ, um mit den Schädeln eine Sammlung zur angeblichen jüdischen Rasse aufzubauen. Lang bezeichnet Hirt als eine moralisch extrem verwerfliche Person, selbst auf der nach oben offenen NS-Skala für Gewissenlosigkeit.
Aber warum ist der 74-Jährige quasi noch immer täglich und im Fulltime-Job in ganz Europa unterwegs, warum ist das Erinnern weiter wichtig? Gerade jetzt, am 27. Januar stellt sich diese Frage mit Macht. Denn im Jahr 1945 erreichte die russische Armee Auschwitz – seit 30 Jahren ist dieser Tag der deutsche Holocaust-Gedenktag.
Für die Angehörigen ist die Geschichte nie vorbei
Für Lang gibt es eine ganz einfache Antwort: „Für die Nachfahren ist der Holocaust nicht Vergangenheit, sondern Gegenwart.“ Als er sich vor Jahrzehnten erstmals getraut hatte, die Enkelin eines der 86 Opfer zu kontaktieren, fürchtete er, die Menschen zu verletzen. Doch die Enkelin sagte: „Sie reißen keine alten Wunden auf – die Wunden sind immer noch offen.“ Für die Nachfahren sei es sehr wertvoll, so Lang, dass sich jemand für das Schicksal ihrer Familie interessiere – nicht nur im Sinne emotionaler Anteilnahme, sondern oft kämen tatsächlich Neuigkeiten heraus. Bei einem Schweizer Nachfahren sei es ihm etwa gelungen, einen bis dahin unbekannten Neffen ausfindig zu machen.
Doch was ist mit jungen Menschen, für die der Holocaust so weit entfernt scheint wie der Dreißigjährige Krieg? Die Experten sind sich einig, dass das Erinnern an die unfassbaren Geschehnisse der Shoah auch für sie sehr sinnvoll sein kann, auf jeden Fall in einem übertragenen Sinne. So betonen die Vereinten Nationen, die vor 20 Jahren den 27. Januar zum weltweiten Gedenktag erhoben haben, dass man an der Ermordung der sechs Millionen europäischen Juden zeigen könne, wie groß die Gefahr sei, sich von Vorurteilen leiten zu lassen und in einen Prozess der Diskriminierung und Entmenschlichung zu geraten.
Beim Holocaust werde zudem offenbar, welche Rolle Angst, Gruppendruck, Gleichgültigkeit, Gier und Ressentiments in sozialen und politischen Systemen spielen könne. Und die Geschichte der Shoah vermittle zugleich Erkenntnisse darüber, dass es selbst in so extremen und verzweifelten Situationen Handlungsmöglichkeiten gebe. Oskar Schindler, der jüdische Zwangsarbeiter rettete, oder Lisa Fittko, die Hunderte von verfolgten Menschen über einen Gebirgspfad in den Pyrenäen in die Freiheit führte, sind überaus starke Vorbilder.
Weitgehend einig sind sich die Wissenschaftler aber auch, dass es neuer Formen der Vermittlung bedarf, sonst erreiche man junge Menschen nicht mehr. Hans-Joachim Lang hat mit weiteren Wissenschaftlern mehrere Seminare an der Universität Straßburg abgehalten und daraus ein Buch gemacht – dabei trafen die Studierenden auch mit Angehörigen der Opfer zusammen: „Wenn man Menschen in den Mittelpunkt stellt, dann wird es plastisch, dann fühlt man plötzlich mit“, ist Lang überzeugt.
Regionales Gedenken bleibt zentral
Auch Michael Blume, seit 2018 Antisemitismusbeauftragter der Landesregierung ist und sich seit Jahrzehnten für ein gutes Miteinander der Religionen einsetzt, betont, dass er Schülerinnen und Schüler stets sage: „Wir erinnern nicht für die Vergangenheit, sondern für eure gemeinsame Zukunft. Gerade heute sehen wir weltweit, wie schnell der Wert der gleichen Menschenwürde und Rechtsstaatlichkeit wieder gekippt werden kann.“ Blume hält – neben dem Einsatz von digitalen Medien – vor allem das regionale Gedenken für wichtig, um jungen Menschen einen Bezug zum Holocaust zu eröffnen: So könnten sie leichter auch emotional erfahren, welche Abgründe der Nationalsozialismus besaß.
Eine dieser regionalen Stätten ist Grafeneck bei Münsingen auf der Alb, wo 1940 insgesamt 10 654 Menschen mit Behinderungen ermordet worden sind. Seit mehr als 30 Jahren beschäftigt sich Thomas Stöckle. der Leiter der Gedenkstätte, mit der Frage der Vermittlung des Holocaust. Er sieht aber keinen Bruch der Erinnerungskultur, sondern eine kontinuierliche Entwicklung – man habe sich schon immer überlegt, wie man zeitgemäß informiere.
So gebe es Kriminalromane über Grafeneck, Musikstücke und Kunstaktionen, sagt Stöckle – der Künstler Jens Meyder etwa hat 10 654 kleine Tonfiguren geschaffen, und jeder Besucher konnte eine davon mit nach Hause nehmen. Vor drei Jahren war die letzte „vergriffen“, jetzt füllen die Besucher das übrig gebliebene Metallgestell mit bemalten und beschriebenen Steinen als Erinnerung an die Opfer. Das Interesse nehme sogar zu: Zu Beginn seiner Arbeit kamen jährlich 40 Besuchergruppen, heute seien es 400. „Mir ist deshalb nicht bange für die Zukunft der Gedenkstätte“, sagt Stöckle.
Thomas Thiemeyer, der an der Universität Tübingen Kulturwissenschaften lehrt und seit langem zur Erinnerungskultur forscht, ist dagegen durchaus der Meinung, dass die alten Muster und Narrative der deutschen Erinnerungskultur nur noch bedingt funktionierten. Denn nicht nur die Zeitzeugen sterben weg, auch viele Ehrenamtliche in den Gedenkstätten werden alt und hören auf. Die jetzige Erinnerungskultur laviere deshalb derzeit zwischen gestern und morgen, heißt es in einem Buch, dass Thiemeyer zu diesem Thema zusammen mit kanadischen und israelischen Wissenschaftlern geschrieben hat.
Aber es entstehen demnach viele neue Ansätze. Ein Beispiel: Das israelische Projekt Eva.stories, bei denen Eva Schloss, die Stiefschwester von Anne Frank, fiktiv Erlebnisse aus ihrem Leben auf Instagram postet. Es gebe Computerspiele, bei denen man sich in die Zeiten des Dritten Reiches begibt, sagt Thomas Thiemeyer. Die Landeszentrale für politische Bildung bildet auch in diesem Jahr wieder Jugendguides aus, die Besucher durch eine Gedenkstätte führen. Und im Zollverein in Essen ist jetzt eine Ausstellung zu sehen, bei der man mit Avataren von überlebenden Shoah-Opfern sprechen kann. Insgesamt, so Thiemeyer, sei Deutschland als Täterland vorsichtiger bei diesen neuen Formen als etwa Israel oder die USA.
Er selbst spricht sich für eine Erinnerungskultur aus, die „weniger direktiv, sondern stärker diskursiv und interaktiv angelegt“ sein sollte. Thomas Stöckle von der Gedenkstätte in Grafeneck unterschreibt dies gerne, fügt aber hinzu: „Die Vermittlung muss grundsätzlich wissenschaftsbasiert bleiben.“ Und es existierten Werte wie Demokratie oder Menschenwürde, die man weitergeben wolle: Sie seien unveränderbar. Das sieht auch Thomas Thiemeyer so. Sonst könnte das Erinnern an den Holocaust zu leicht von rechten Strömungen missbraucht werden.