Verfassungsschutz
Was bedeutet „gesichert rechtsextremistisch“?
Hier erfahren Sie, was man unter "gesichert rechtsextremistisch" versteht und welche Konsequenzen eine solche Einstufung haben kann.
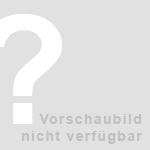
© Jarretera / shutterstock.com
Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die AfD als "gesichert rechtsextremistisch" eingestuft.
Von Lukas Böhl
Am 2. Mai 2025 hat das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) die „Alternative für Deutschland“ (AfD) als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft. Diese Bewertung beruht laut der Behörde auf einer umfassenden Prüfung zahlreicher Äußerungen, Programminhalte und Verhaltensweisen der Partei sowie ihrer Funktionäre. Doch was bedeutet dieser Begriff genau? Und welche Folgen kann eine solche Einstufung haben?
Definition: Was bedeutet „gesichert extremistisch“?
Laut der Bundeszentrale für politische Bildung handelt es sich bei einer Organisation dann um eine „gesichert extremistische“ Gruppierung, wenn für die zuständigen Verfassungsschutzbehörden kein Zweifel mehr besteht, dass diese Organisation aktiv gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung wirkt. Dabei geht es insbesondere um Bestrebungen, die auf die Beseitigung zentraler Verfassungsprinzipien wie Menschenwürde, Demokratie oder Rechtsstaat abzielen – oder etwa auf die Gefährdung des friedlichen Zusammenlebens der Völker oder des Bestands der Bundesrepublik Deutschland.
Die Bezeichnung „gesichert extremistisch“ stellt somit den höchsten Schweregrad innerhalb der Bewertungsskala des Verfassungsschutzes dar. Zuvor kann eine Gruppierung etwa als „Verdachtsfall“ oder „Prüffall“ eingestuft werden. Mit dem Label „gesichert extremistisch“ ist eine deutlich klarere sicherheitsbehördliche Einschätzung verbunden.
Wer entscheidet über die Einstufung – und was folgt daraus?
Die Entscheidung über die Einstufung trifft die jeweilige Verfassungsschutzbehörde – auf Bundesebene das BfV, in den Ländern die jeweiligen Landesämter. Dabei stützen sich die Behörden auf eine Vielzahl von öffentlich zugänglichen und nicht-öffentlichen Informationen. Dennoch gilt: Der Verfassungsschutz ist keine Strafverfolgungsbehörde. Eine solche Einstufung hat zunächst keine direkten rechtlichen Konsequenzen für die Organisation selbst. Es erfolgt kein Verbot und keine strafrechtliche Sanktion allein aufgrund dieser Bewertung.
Die gesammelten Informationen werden jedoch an Regierung, Parlamente sowie an Polizei und Staatsanwaltschaft weitergegeben. Auch die Öffentlichkeit wird regelmäßig in Form von Verfassungsschutzberichten informiert.
Konsequenzen für Organisationen und Mitglieder
Obwohl eine Einstufung als „gesichert extremistisch“ nicht automatisch ein Verbot bedeutet, kann sie Auswirkungen haben – vor allem auf Personen, die in einem besonderen Dienstverhältnis zum Staat stehen. Beamtinnen und Beamte, Soldatinnen und Soldaten sowie Richterinnen und Richter sind zur Loyalität gegenüber der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verpflichtet.
Die Mitgliedschaft in einer als gesichert extremistisch eingestuften Organisation kann daher disziplinarrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Diese reichen von Verweisen über Gehaltskürzungen bis hin zur Entfernung aus dem Dienst.
Ein Verbot einer Partei oder eines Vereins ist hingegen an besonders hohe juristische Hürden gebunden. Parteien dürfen in Deutschland nur durch das Bundesverfassungsgericht verboten werden – und auch nur auf Antrag von Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung. Für Vereinsverbote sind das Bundesinnenministerium beziehungsweise die jeweiligen Landesinnenministerien zuständig, geregelt ist dies im Vereinsgesetz.
Möglichkeiten des rechtlichen Widerspruchs
Gegen eine Einstufung durch den Verfassungsschutz können sich betroffene Organisationen juristisch zur Wehr setzen. Gerichte prüfen dann, ob die behördlichen Anhaltspunkte und Bewertungen ausreichen, um die Organisation als extremistische Bestrebung einzustufen oder zu beobachten.



