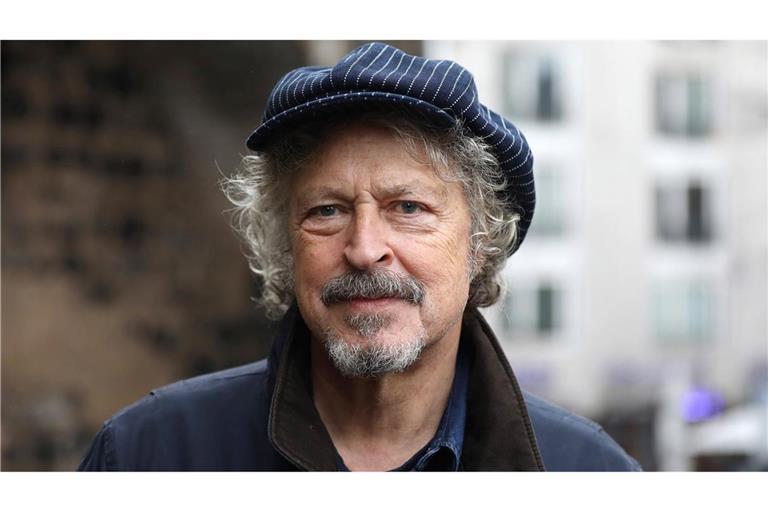Musik und Politik
Was Nationalhymen über Völker verraten
Nationalhymnen sind feierliche Lob- oder Festgesänge eines Staates. Sie verraten einiges über ihre Länder und sind nicht zufällig verteilt, wie Forscher herausgefunden haben.

© Imago/Dreamstime
Nationaflaggen vor dem UN-Hauptgebäude in New York.
Von Markus Brauer
Der Linken-Politiker Bodo Ramelow hatte sich jüngst dafür ausgesprochen, über die deutsche Nationalhymne abzustimmen. Er würde „gerne die Kinderhymne von Bertolt Brecht zur Abstimmung stellen“. „Die Kinderhymne hat einen wunderbaren Text. Über die Passage, dass ein besseres Deutschland blühe, könnten wir Zugang zu einer gesamtdeutschen Hymne finden, die wir alle zusammen mit Freude singen könnten.“
Auf den politischen Streit, den er damit vom Zaune brach, antwortete Ramelow: Er habe nur gesagt, dass es Menschen gebe, die mit der Flagge fremdeln. Er verwies darauf, dass etwa in Thüringen teils Reichsflaggen oder umgedrehte Deutschlandfahnen in Gärten hingen. Auch die erste Strophe des Deutschlandliedes, die wegen der Nutzung durch die Nazis historisch belastet ist, werde immer wieder bei Veranstaltungen gesungen.
Feierlich Lob- oder Festgesänge
Nationalhymnen verraten einiges über ihre Länder und sind nicht zufällig verteilt. Sie sind feierliche Lob- oder Festgesänge eines Staates, mit dem sich Staaten zu besonderen Anlässen präsentieren und selbst huldigen.
Die musikalischen Unterschiede sind gravierend: So haben Länder in Äquatornähe meist dynamischere Nationalhymnen, nördlich davon sind die Hymnen hingegen eher getragener, im Süden hingegen eher fröhlich. Zusätzlich gibt es Unterschiede zwischen den Kontinenten und der Gesellschaftsform der jeweiligen Länder, wie eine Analyse der Melodien von 176 Hymnen ergab.
Nationalhymnen als Exportschlager
Manche Hymnen wurden zu Exportschlagern. So wurde die Melodie der britischen Nationalhymne „God Save the King/Queen“ von einigen anderen Ländern übernommen, wie zum Beispiel von Preußen („Heil dir im Siegerkranz“, ab 1871 deutsche Kaiserhymne), der Schweiz („Rufst du, mein Vaterland“ – heute nicht mehr Nationalhymne) oder Liechtenstein („Oben am jungen Rhein“).
Nationalhymen sind zudem mehr als nur rituelle Musik und pathetisches oder alltägliches Identifikationsmerkmal. Sie sind auch eine Art Charakterausdruck und nationales Ortsschild. Denn die Nationalhymnen spiegeln auch die kulturellen und geografischen Besonderheiten der einzelnen Länder wider.
Wer’s hören will: Die Soloklavier-Komposition „Hämmerklavier XIX: Hymnen der Welt (Afghanistan bis Zimbabwe)“ des deutschen Komponisten und Pianisten Moritz Eggert aus dem Jahr 2006 zitiert in elf Minuten fast alle damals aktuellen Nationalhymnen der Welt in alphabetischer Reihenfolge.
Zusammenhang zwischen Melodie und Gefühl?
Was Nationalhymnen über die Gefühle der jeweiligen Bevölkerung aussagen, haben nun Forscher um Petri Toiviainen von der Universität Jyväskylä in Finnland im Fachjournal „Scientic Reports“ näher untersucht. Dafür analysierten sie mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die musikalischen und emotionalen Merkmale der Hymnen von 176 Ländern weltweit – unabhängig von deren Text.
Das Team untersuchte akustische Merkmale wie Harmonie, Klangfarbe, Rhythmus und Tonhöhe der Hymnen und verglich, welche Emotionen diese transportieren. Unter den acht untersuchten Gefühlskategorien waren zum Beispiel Freude, Trauer, Angst, Wut sowie Erregung im Sinne von Energie oder Spannung.
Die so erstellten emotionalen Profile der Hymnen katalogisierten die Wissenschaftler anschließend nach geografischer Lage des Landes. Zudem verglichen sie das Gefühlsprofil der Nationalhymne mit den kulturellen Merkmalen der Landesbewohner.
- Übrigens: Die japanische Nationalhymne „Kimi Ga Yo“ beinhaltet den ältesten Text (um 905 n. Chr,). Ihre Melodie wurde jedoch erst am Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben.
- Als Einheit von Text und Melodie ist die seit dem 16. Jahrhundert gesungene niederländische Hymne „Het Wilhelmus“ die älteste der heutigen Nationalhymnen.
Geografische Lage und gesellschaftlicher Einfluss
- Länder, die näher am Äquator liegen, beinhalten in ihren Hymne tendenziell ein höheres Maß an musikslischer Energie und Dynamik.
- Die Hymnen von Nationen höherer Breiten sind dagegen tendenziell ruhiger und entspannter.
- Aber auch unter ihnen gibt es Unterschiede: Nördliche Länder haben eher traurige, äquatoriale und südliche Länder eher fröhliche Hymnen.
- Im Gegensatz dazu zeigten Emotionen wie Wut und Angst eher eine Ost-West-Verteilung:
- Diese Gefühle tauchen vor allem in den Hymnen von Ländern der westlichen Hemisphäre auf.
- In der östlichen Hemisphäre überwiegen hingegen Nationalhymnen mit positiver Grundstimmung.
- Aber auch zwischen den Kontinenten gibt es Unterschiede:
- So transportieren zum Beispiel Nationalhymnen aus Ozeanien am meisten Freude, wie die KI-Analysen ergaben.
- Hymnen aus Nord- und Südamerika sind generell angespannter, ängstlicher und negativer als die aus anderen Weltregionen. Das lässt sie intensiver und dringlicher klingen.
- Auch die Kultur und Gesellschaftsform haben großen einen Einfluss auf die Nationalhymne: Kollektivistische Länder mit starker Hierarchie und großem Machtgefälle wie Ekuador haben energischere, kraftvollere Hymnen.
- Individualistischere Kulturen mit flachen Hierarchien und hoher Autonomie der Bevölkerung wie Dänemark oder Neuseeland haben hingegen Hymnen mit wenig Perkussion, die sanfter, ruhiger und weniger angespannt sind, wie die Analyse ergab.
- „Nachgiebige Gesellschaften, die Genuss und Befriedigung von Wünschen betonen, neigen zu Hymnen, die ein höheres Maß an Angst ausdrücken“, fanden die Forscher heraus.
- Global betrachtet am fröhlichsten sind die Staatshymnen der Westsahara und China. Die traurigsten hingegen sind die von Japan, Israel und Liechtenstein.
- Ein besonders hohes Maß an Wut zeigen dagegen beispielsweise die Hymnen von Katar, Sudan und Nigeria.
- Von starker Angst zeugen die Nationalhymnen Katars, Jamaikas und Liechtensteins.
- Die deutsche Nationalhymne sticht in keiner Gefühlskategorie besonders hervor und zeigt gemischte Merkmale: Sie ist tendenziell eher getragen, hat aber zugleich eine positive Grundstimmung.
Hymnen verraten emotionales Erbe
„Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Nationalhymnen sowohl geografische als auch kulturelle Merkmale von Nationen in ihrem musikalischen Ausdruck widerspiegeln“, erklärt Toiviainen. „Das bietet eine neue Möglichkeit, nationale Identität durch Musik zu betrachten.“
Allerdings, so die Forscher weiter, spiegelten Nationalhymnen nicht per se „die aktuelle (oder frühere) Stimmung und Identifikation der Bevölkerung mit ihren Nationalhymnen wider“.