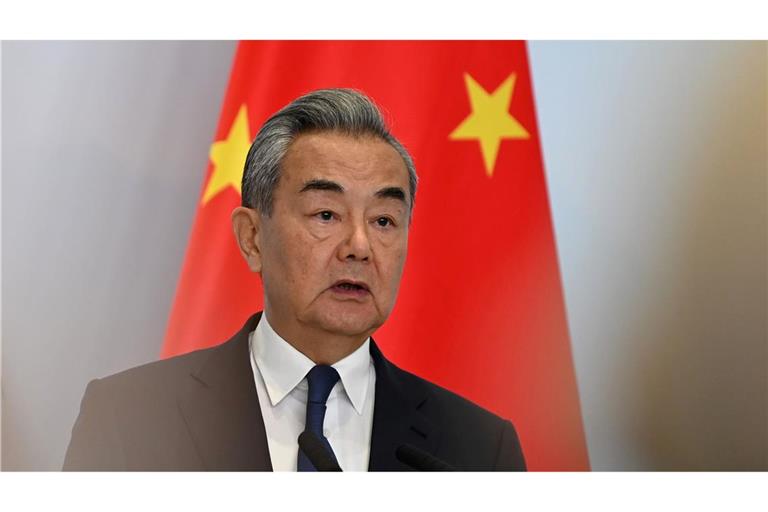Bund, Länder und das Geld
Wer bestellt, bezahlt – vielleicht
Bund und Länder pokern um Milliarden, wenn es um die Kosten von Gesetzen geht. Für viele Kommunen geht es ums finanzielle Überleben.

© Britta Pedersen/dpa
Für was muss Finanzminister Lars Klingbeil in seinen Etat greifen – und wo sind stattdessen die Länder gefordert?
Von Tobias Peter
Es gibt diesen Moment in der Kneipe, in dem alles klar ist. Der Moment, in dem einer am Tisch sagt: „Ich gebe einen aus. Was wollt ihr trinken?“ Dann geht er mit den gesammelten Wünschen an die Theke. Er bestellt – und am Ende bezahlt er dann natürlich auch.
Im Föderalismus – also im Verhältnis von Bund, Ländern und Kommunen – ist das komplizierter. Das fängt schon bei den Begriffen an. Man spricht vom Konnexitätsprinzip, wenn es um das Motto „Wer bestellt, bezahlt“ geht. Doch wann gilt diese Vorgabe tatsächlich, wann gar nicht oder nur begrenzt? Und: Lässt sich das alles überhaupt so genau regeln, wenn die Rechnung komplizierter ist als „Vier Bier und zwei Cola, bitte“?
Der Brandbrief der Kommunen
Im Verhältnis von Bund, Ländern und Kommunen geht es um viel Geld, heikle Streitpunkte und – aus deren Sicht – um das Überleben von Städten und Gemeinden. Das zeigt ein Brandbrief, den die Oberbürgermeister aller 13 deutschen Flächenländer gerade an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und die Ministerpräsidenten geschrieben haben. „Die Schere zwischen kommunalen Einnahmen und Ausgaben öffnet sich immer weiter“, warnen sie in dem Brief. Jedes Gesetz, das Belastungen für die Kommunen nach sich ziehe, müsse einen vollständigen Ausgleich vorsehen, fordern sie.
Wenn in der Bundesrepublik Deutschland zwischen den unterschiedlichen staatlichen Ebenen um Geld gerungen wird, geht es mitunter um blanke Not, wie sie viele Kommunen zu spüren bekommen. Gerade im Streit zwischen Bund und Ländern geht es aber auch um Tarnen und Täuschen. Es ist ein Pokerspiel – mit Milliardeneinsätzen.
Einer, der sich mit den Verhältnissen im Bundesstaat auskennt wie kaum ein anderer, ist Joachim Wieland. Der Professor, der zu Fragen des Verfassungs- und Steuerrechts forscht, hat lange die Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer geleitet. Er unterscheidet zwischen dem Verhältnis von Ländern und Kommunen sowie der Beziehung des Bundes zu den Ländern. Gerade Vertreter der Kommunen würden noch hinzufügen: Man muss beim Konnexitätsprinzip auch unterscheiden zwischen Theorie und Praxis.
Die hohen Kosten im sozialen Bereich
Der Bund macht Gesetze, an denen die Länder im Bundesrat mitwirken können. Die Länder vertreten dabei auch die Kommunen. Deshalb habe sich, erklärt Wieland, im Verhältnis von Ländern und Kommunen das Konnexitätsprinzip durchgesetzt. Der Grundsatz „Wer bestellt, bezahlt“ sei in den Landesverfassungen verankert. Das bedeutet: „Wenn die Länder gegenüber dem Bund neuen Regelungen zugestimmt haben, die Geld kosten, dann dürfen sie den Kommunen nicht einfach diese Aufgaben übertragen, ohne einen Ausgleich zu schaffen.“
Also alles in Ordnung für die Kommunen? Von wegen, sagen diese. Neben manch komplizierter Rechtsfrage, die sich um das Thema Konnexität rankt, verweisen sie darauf, dass in vielen Bereichen die Kosten gestiegen sind. Wenn etwa die Zahl der Minderjährigen, deren Lebenssituation durch kaputte Familien geprägt ist, zunimmt, steigen auch die Kosten der Kinder- und Jugendhilfe. Dass solche Leistungen verstärkt gebraucht werden, hat keiner bestellt – bezahlt werden muss es trotzdem. Gerade im sozialen Bereich sind die Kosten hoch.
Und wie ist es im Verhältnis von Bund und Ländern? „Die Länder würden das Konnexitätsprinzip am liebsten eins zu eins auf das Verhältnis des Bundes zu den Ländern übertragen“, sagt Verfassungs- und Verwaltungsexperte Wieland. „Sie wünschen sich: Der Bund soll komplett für Kosten aufkommen, die den Ländern aus seinen Entscheidungen entstehen.“ Er meint: „Das klingt logisch, ist es aber nicht.“
Die mühsame Aufteilung der Rechnung
Wieland begründet das so: Weil die Länder im Bundesrat beteiligt sind, wäre es unsinnig, wenn sie ein automatisches Recht auf Kostenerstattung hätten. „Sie können ja auch einfach Nein zu einem Gesetz sagen.“ Er erklärt das anhand eines aktuellen Streits zwischen Finanzminister Lars Klingbeil und den Ländern. Die Mehrwertsteuer fürs Schnitzel in der Kneipe soll statt 19 nur noch 7 Prozent betragen. Doch wer kommt für die Lücke in den Haushalten auf?
„Für die Länder ist es bequem zu sagen: Das Gesetz für eine dauerhaft niedrigere Mehrwertsteuer für die Gastronomie ist von der Bundesregierung auf den Weg gebracht worden, deshalb soll der Bund alles bezahlen“, sagt Wieland. Aufgabe der Länder sei allerdings zu überlegen, „ob eine Steuersenkung sinnvoll und für sie verkraftbar sind, und dann entscheiden, ob sie im Bundesrat zustimmen oder nicht“.
Das Verhältnis zwischen Bund, Ländern und Kommunen wird in finanzieller Hinsicht immer kompliziert sein. Das ist der Preis für ein System von Kontrolle und Gegenkontrolle. Der Grundsatz „Wer bestellt, bezahlt“ soll vor allem die Kommunen schützen. Klar ist nur: Keiner will alle einladen. Deshalb muss die Rechnung in der Kneipe manchmal mühsam aufgeteilt werden.