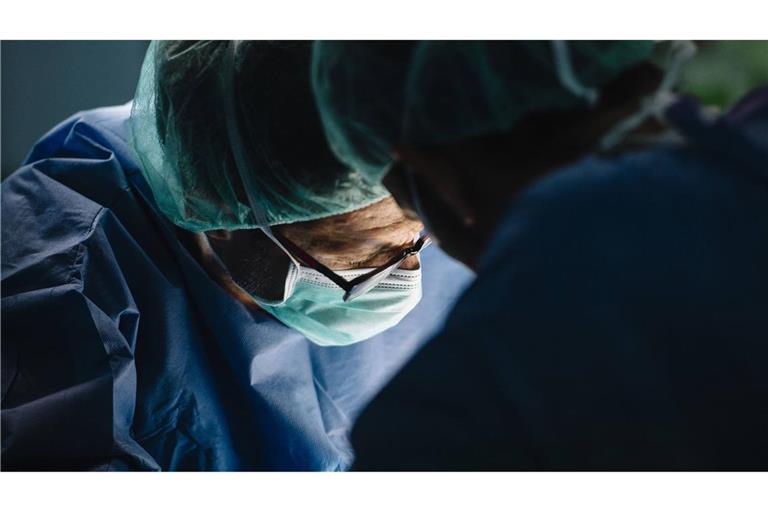Vor 5,3 Millionen Jahren
Wie das Mittelmeer durch eine Megaflut entstand
Als vor 5,3 Millionen Jahren die Barriere zwischen Atlantik und Mittelmeer brach, folgte eine der größten Sturzfluten. Ihren Verlauf haben Forscher jetzt rekonstruiert.

© mago/Sportfotodienst
Die Öffnung der Straße von Gibraltar löst vor 5,3 Millionen Jahren die abrupteste Überflutung der Erdgeschichte aus. Eine neue Studie offenbart die gewaltigen Dimensionen dieser Urflut.
Von Markus Brauer/dpa
Gegen solch einen gewaltigen Wasserschwall wirken die Niagara- und Viktoria-Fälle zusammen wie ein Rinnsal: Forscher haben die Entstehung des Mittelmeers vor rund 5,3 Millionen Jahren rekonstruiert.
Damals sorgte die Öffnung der heutigen Straße von Gibraltar dafür, dass Wasser aus dem Atlantik in das Mittelmeerbecken schwappte und diese Senke der Untersuchung zufolge binnen zwei Jahren flutete.
Das Team um den Geowissenschaftler Udara Amarathunga von der Princeton University im US-Bundesstaat New Jersey spricht in der im Fachblatt „Proceedings of the National Academy of Sciences“ veröffentlichten Studie von der abruptesten Überflutung der dokumentierten Erdgeschichte.
Überbleibsel des Urozeans Thetys
Vor rund sechs Millionen Jahren machte eine tektonische Hebung die Meerenge von Gibraltar zur Barriere und schnitt das Mittelmeer von seinem wichtigsten Wasserzustrom ab – dem Atlantik. Das Mittelmeerbecken trocknete weitgehend aus. Von dieser Messinischen Salzkrise (Messinian Salinity Crisis/MSC) zeugen bis heute kilometerdicke Salzablagerungen an den tiefsten Stellen des Beckens. Erst vor rund 5,3 Millionen Jahren endete dieser Zustand, als sich das Atlantikwasser wieder einen Weg durch den Damm von Gibraltar.
Wie sich das Becken nach der Salzkrise füllte, bietet seit Jahren Stoff für Diskussionen. Einigen Daten zufolge floss das Atlantikwasser zwar zügig, aber ohne Sturzflut zurück ins Mittelmeer. Andere Indizien sprechen hingegen für eine katastrophale Sturzflut, die das Mittelmeer innerhalb von nur zwei Jahren wieder komplett auffüllte.
„Auch nach fünf Jahrzehnten der Forschung sind die Pegelunterschiede und die Folgen der Wiederauffüllung umstritten“, schreiben Udara Amarathunga und seine Kollegen.
Ein Bohrkern und das „Rätsel-Sapropel“
Um die strittigen Fragen zu klären, untersuchte das Team nun Bohrkerne aus dem Meeresgrund des östlichen Mittelmeerbeckens nahe Sizilien per Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA). Seine Schichten umfassen sowohl die messinische Salinitätskrise, als auch die Wiederauffüllung – und eine Schicht, die als „Rätsel-Sapropel“ bekannt ist.
Dabei handelt es sich um eine Faulschlammschicht, die direkt nach Wiederöffnung der Gibraltarbarriere abgelagert wurde. Wie und warum sie entstand, ist ebenso unklar wie der genaue Ablauf der Mittelmeer-Wiederbefüllung.
Diese Fragen haben nun Amarathunga und sein Team noch einmal genauer untersucht. Mithilfe der Bohrkerndaten rekonstruierten sie die Bedingungen vor, während und nach der Neuflutung des Mittelmeeres und testeten verschiedene Szenarien mithilfe einer Modellsimulation. „Dadurch erhalten wir einen detaillierten Einblick in diese enigmatische Endphase unmittelbar nach der zancleanischen Megaflut“, erklären die Forscher.
Indizien für gigantischen Wassereinstrom
Die Analysen bestätigen das Szenario einer abrupten Megaflut: Am Ende der messinischen Austrocknung zeigten sich im Bohrkern zunächst Indizien für eine stark Austrocknung. Dann folgte eine deutliche geologische Veränderung verbunden mit abrupten Sprüngen in einigen Elementen, darunter Aluminium, Molybdän und Sauerstoff. „Wir interpretieren diesen Anstieg als Folge eines plötzlichen Einstroms von Atlantikwasser in das östliche Mittelmeerbecken“, schreiben die Geologen.
Demnach strömte vor rund 5,3 Millionen Jahren plötzlich eine große Menge stark durchmischtes, sauerstoffreiches Wasser in das ausgetrocknete Becken. Indizien für eine solche Sturzflut liefern auch Strukturen am Meeresgrund.
„Von einem schnellen Wiederauffüllungsereignis zeugen unter anderem Erosionsspuren im westlichen Mittelmeer, Ablagerungskonturen bei Sizilien und chaotische Sedimentablagerungen am Fuß des Malta-Steilhangs“, berichtet das Team. Dies legt nahe, dass das Atlantikwasser mit beträchtlicher Wucht in die Mittelmeerbecken strömte.
Megaflut in zwei Schritten
Als das Wasser im westlichen Becken diese Schwelle überflutete, stürzte es in einem gewaltigen Wasserfall etwa 1500 Meter in die Tiefe und füllte dann auch die jenseitige Hälfte auf. Dabei kam es zunächst zu einer Verwirbelung und Durchlüftung der Wassersäule. Danach füllte sich das Mittelmeerbecken in zwei Phasen:
- In einem ersten Schritt sammelten sich die Wassermassen im westlichen, bis 3000 Meter tiefen Teil. Dieser ist von der östlichen, stellenweise mehr als 5000 Meter tiefen Hälfte abgeriegelt durch die sogenannte Sizilien-Malta-Schwelle – einen von Norden nach Süden verlaufenden, weit aufragenden Meeresrücken. „Numerische Simulationen sprechen dafür, dass das Wasser dabei mit 150 Milliarden Litern pro Sekunde und einem Tempo von bis zu 50 Meter pro Sekunde in das Alboran-Becken strömte“, berichten die Forscher.
- Der zweite Schritt folgte, als die Wassermassen auch die Schwelle zum östlichen Mittelmeerbecken südlich von Sizilien erreichten. „Die Kaskade, die nun in das östliche Becken strömte, muss noch energiereicher gewesen sein, weil der Meeresgrund am Malta-Steilhang stark abfiel“, erklären Amarathunga und sein Team. An dieser Steilkante entstand ein 1,5 Kilometer hoher Wasserfall, über den enorme Wassermassen in die Tiefe stürzten. Als Folge wurde nun auch das östliche Mittelmeer abrupt mit frischem, sauerstoffreichem Wasser geflutet, wie die Bohrkerndaten zeigen.
Schnellste Sturzflut der Erdgeschichte
„Unsere Studie stützt damit die Megaflut-Hypothese, nach der die schnellste bekannte Sturzflut der Erdgeschichte die messinische Salinitätskrise beendete und das Mittelmeer von einem substanziell abgesunkenen Pegel wieder auffüllte“, konstatieren die Geologen. Ihren Berechnungen zufolge dauerte diese Wiederbefüllung des Mittelmeeres nur rund 700 Tage – nicht einmal zwei Jahre.
Gleichzeitig liefern die neuen Daten auch eine Erklärung für das Rätsel-Sapropel im östlichen Mittelmeerbecken. Demnach kam diese Faulschlammschicht zustande, weil die einstürzenden Wassermassen zwar frischen Sauerstoff mitbrachten.
Doch durch den hohen Salzgehalt des Restwassers bildete sich nach Ende der Turbulenzen schnell eine starke Schichtung im neu befüllten Becken: Das salzige, alte Wasser sank nach unten und bildete dort einen im Laufe der nächsten 12.000 Jahre zunehmend sauerstoffarmen Bodensatz.
Weil das Plankton in den oberen, frischen Wasserschichten aufblühte, sanken in dieser Zeit viele organische Reste in die sauerstoffarmen Tiefen und bildeten dort die Faulschlammablagerungen. „Nach Ende der Flut dauerte es 33.000 Jahre, bis diese Schichtung sich abschwächte und Konvektionsströmungen das Tiefenwasser erneuerten“, erklären die Wissenchaftler.