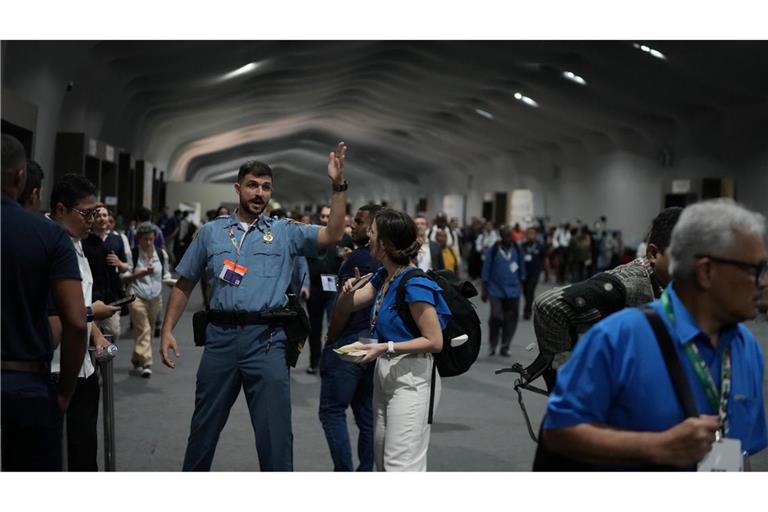Genuas Wiederauferstehung
Wie die Menschen im Schatten der Morandi-Brücke in den Alltag zurückfinden
Morandi-Brücke - 43 Menschen sind beim Einsturz der Morandi-Brücke gestorben. Die Menschen, die in den Häusern unter der Brücke lebten, können nicht zurück. Sie hoffen auf einen Neuanfang.
Genua „Das ist wie ein großes Lego-Spiel“, sagt Anna Rita Certo. „Sie bauen die Brücke genauso wieder ab, wie sie sie damals vor 56 Jahren aufgebaut haben“, erzählt die 62-Jährige. Als Kind habe sie vom Balkon aus stundenlang zugeschaut, wie die Morandi-Brücke entstand. „Sie schaffen etwas Wunderbares“, habe das kleine Mädchen damals gestaunt. Ihre Freundin Giusy Moretti unterbricht die Erinnerungen mit einem einzigen Satz: „Ja, und dann hat sie uns betrogen, die Brücke.“
Rund ein halbes Jahr ist er her, dieser Betrug. Am 14. August vergangenen Jahresum 11.36 Uhr stürzte die Morandi-Brücke, die Hauptverkehrsader der norditalienischen Hafenstadt Genua, plötzlich ein.43 Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben. 619 mussten – wie auch Anna Rita Certo und Giusy Moretti – ihre Häuser für immer verlassen.
„Es ist das gelbe Haus, dort hinten“, sagt Anna Certo und zeigt durch die Absperrung auf ihre alte Heimat in der Via Enrico Porro, direkt unter der Fahrbahn, die seit sechs Monaten ins Nichts ragt. In der Wohnung ihrer Eltern hat sie zusammen mit ihrer älteren Schwester Mimma bis zum Einsturz gelebt. Mit dem Abriss der Restbrücke wird auch das Elternhaus der Schwestern Certo dem Boden gleichgemacht werden. Im April oder Mai soll es so weit sein. „Uns wurde versprochen, dass wir noch einmal in unsere Wohnungen dürfen, um uns zu verabschieden. Ob das wirklich klappt, steht aber noch nicht fest.“
Ihre alten Wohnungen wurden ihnen bereits von Autostrade, der ehemaligen Betreibergesellschaft der Brücke, abgekauft, erzählen die beiden Frauen: 2025 Euro pro Quadratmeter hat jeder Wohnungsbesitzer bekommen. Plus einen Bonus von 45 000 Euro, plus weitere 36 000 Euro Entschädigung. Diese beiden letzten Summen stünden auch den Menschen zu, die zur Miete in einem der Häuser gewohnt haben. „Sie warten allerdings noch auf ihr Geld“, sagt Moretti, die auch das „Commitato Via Porro“, einen Zusammenschluss der Anwohner, koordiniert.
Die meisten der einstigen Bewohner der jetzigen Sperrzone leben heute in Mietwohnungen – kostenfrei, die Stadt übernimmt die Miete für ein Jahr. Anna Certo wohnt weiter mit ihrer Schwester zusammen in deren Zweitwohnung in der Altstadt. „Die wollten wir eigentlich gerade verkaufen, da brach die Brücke ein.“
Zur Unglücksstelle kämen immer weniger ehemalige Anwohner. „Die meisten arbeiten, haben eine neue Wohnung weiter weg, und haben ihr Leben wieder in die Hand genommen“, sagt Moretti. Nach den Tagen und Wochen des Schreckens und der Trauer hat sich auch die Situation in Genua langsam wieder normalisiert. Der Verkehr fließe wieder, hört man von den Genuesen, die Stadt habe schnell gehandelt und alternative Routen freigemacht.
Anfang Februar konnten auch endlich die Abrissarbeiten der verbliebenen Brückenteile beginnen, vergangene Woche wurde ein weiteres großes Teil weggeschafft. „Jede Woche demontieren wir ein Stück“, hatte Marco Bucci, der Bürgermeister der Stadt und der Kommissar für den Wiederaufbau der Brücke, den Bürgern versprochen. Die neue Brücke soll im April 2020 für den Verkehr geöffnet werden. Rund 200 Millionen Euro soll das Viadukt über den Polcevera-Fluss kosten. 43 Lichtsäulen darauf sollen an die Toten erinnern. Der Entwurf stammt von dem Genueser Star-Architekten Renzo Piano.
Wer für den Einsturz der Brücke verantwortlich ist, konnte juristisch noch nicht geklärt werden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 20 Personen sowie gegen den Autobahnbetreiber Autostrade per l’Italia. Noch laufen die Untersuchungen, doch die Zwischenberichte sind an die italienischen Medien durchgesickert. Demnach sollen die mangelhaft gewarteten und durchgerosteten Trägerseile der Brücke gerissen sein und die Katastrophe ausgelöst haben.
„Es ist, wie wenn man auf einen Friedhof geht“, beschreibt Anna Certo das Gefühl, das sie überkommt, wenn sie die Unglücksstelle besucht und auf ihr Haus und die Reste der Morandi-Brücke blickt. „Man besucht einen Ort, an dem kein Leben ist. Ich bin in Gedanken immer bei denen, die nicht mehr sind.“ Immer am 14. jeden Monats versammeln sich die „Sfollati“, die Vertriebenen, zu einer Gedenkfeier in der Sperrzone. „Zum Glück hat mein Vater den Einsturz nicht mehr erlebt“, sagt Anna Certo. Sie und ihre Schwester pflegten die Eltern lange, der Vater starb 2015. Im stolzen Alter von 103 Jahren. „Am Schluss konnte er nicht mehr laufen. Er saß immer auf dem Balkon und schaute auf die Brücke. Das war für ihn ein Stück Heimat.“