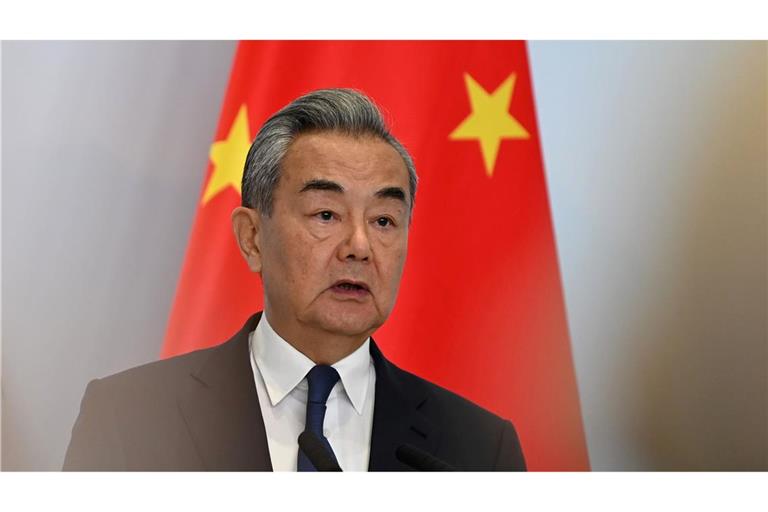Auto-Diskussion bei Caren Miosga
Özdemir bezweifelt Verbrenner-Aus in 2035
Der grüne Spitzenkandidat für Baden-Württemberg, Cem Özdemir, bezweifelt ein Verbrenner-Aus im Jahr 2035 und hält andere Dinge für das „Autoland“ für entscheidender.

© IMAGO/HMB-Media
Bei Caren Miosga war am Sonntagabend unter anderem auch Cem Özdemir zu Gast.
Von Christoph Link
Um die Krise der Autoindustrie ging es am Sonntag in der Talkrunde von Caren Miosga in der ARD: Gewinneinbrüche bei Mercedes, Porsche und VW, prognostizierte Jobverluste von bundesweit 190.000 Stellen in der Autoindustrie bis 2030, davon ein Drittel im Südwesten. Die Krisensymptome sind allgegenwärtig. Für Cem Özdemir, den ehemaligen Bundeslandwirtschaftsminister und Grünen-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, handelt es sich um eine strukturelle Krise, die die Autoindustrie ergriffen hat und die flankiert wird von hohen US-Zöllen und den Marktveränderungen in China. „Aber wir sollten nicht Trübsal blasen. Die deutschen Autos sind konkurrenzfähig und müssen sich nicht verstecken“, meinte Özdemir.
Diesen Eindruck habe er auf der IAA gewonnen. Die deutschen Entwickler hätten ihre Chance noch in der KI, der Robotik, dem autonomen Fahren und der Vernetzung von Autos. Was den Verbrennermotor angehe, da sei „die Messe gelesen“. „Die Autos der Zukunft sind elektrisch. Wir sollten aufhören, darüber zu streiten.“
Kontra zur Parteilinie
Gleichwohl setzte Özdemir in der Sendung auch einen Kontrapunkt zur Leitlinie seiner Partei, in der die Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge es „als großen Fehler“ bezeichnet hatte, sollte man das europäische Aus für den Verbrennermotor für 2035 in Frage stellen. In Baden-Württemberg sei Mathe als Schulfach nicht abzuwählen gewesen, meinte Özdemir und die einfache Mathematik aber sage ihm, dass das Verbrenner-Aus bis 2035 nicht zu schaffen sei. Gespräche mit Auto-Zulieferern, die Baden-Württemberg im Gegensatz zu anderen Bundesländern habe, hätten das untermauert.
Der Verbrenner werde ja nach 2035 nicht vom Markt verschwinden, der Bestand dieser Autos sei ja noch da. „Ob wir das Verbrenner-Aus jetzt 2035 oder 2037 erreichen, das ist nicht entscheidend. Hauptsache, die Richtung stimmt. Wir sollten alles in Bewegung setzen, so nahe wie möglich am Ziel zu landen“, meinte Özdemir. Wichtig sei es, jetzt sofort die Ladeinfrastruktur auch europaweit auzubauen, die Stromkosten zu senken und die Wettbewerbsbedingungen für die deutsche Autoindustrie zu verbessern.
Industriepolitik fehlt
Von Hildegard Müller, der Präsidentin des Verbandes der Autoindustrie, ist Özdemir daraufhin aufgefordert worden, seinen „Einfluss“ auch bei den Bundes-Grünen und den europäischen Grünen geltend zu machen. Auch die Autoindustrie wünscht sich mehr „Flexibilität“ beim Verbrenner-Aus. Müller wies daraufhin, dass sieben von zehn Elektroautos, die hierzulande verkauft werden, immer noch in Deutschland hergestellt werden, europaweit sei es jedes zweite.
Die deutsche Autoindustrie nehme die Herausforderungen an und werde in den nächsten vier Jahren 320 Milliarden Euro in die Erforschung und Entwicklung neuer Antriebe investieren. Anders als China fehle in Europa eine strukturierte Industrie- und Handelspolitik. „Wo sind denn beispielsweise die Handelsabkommen der EU mit afrikanischen Staaten“? fragte Müller. Für den Aufbau einer unabhängigen Batterieproduktion in Europa benötige man Rohstoffe, eine wettbewerbsfähige Energiepolitik und den Willen, Industrieproduktion auch anzusiedeln. „Und das kann ich leider nicht erkennen.“
Der zweite China-Schock
Pessimistisch äußerte sich auch Moritz Schularick, der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Er sprach vom „zweiten China-Schock“, der nach dem ersten, der erkennbaren Industrialisierung Chinas, jetzt erfolge: „Europa ist jetzt wirklich im Visier der Chinesen. Sie haben uns überholt.“ Die Frage von Caren Miosga, ob es die deutschen Automarken VW, BMW und Mercedes in ihrer jetzigen Form in zehn Jahren noch geben werde, ist von Schularick verneint worden. Die werde es in der Form schon Ende des Jahrzehnts nicht mehr geben. Er könne sich für sie eine Lösung wie bei Volvo vorstellen, dass also ein Investor einsteigt und Technologie mitbringt und den Marktzuzgang zu Europa erhält. Von Cem Özdemir ist diese Vorstellung missbilligt worden. Er wolle, dass Daimler, gegründet von Benz, Daimler und Maybach ein deutsches Produkt bleibe. Wenn alle ihren Job machten, sei das auch zu schaffen.
Sind die Grünen Ballast für Özdemir?
Laut den Umfragen zur Landtagswahl liegen die Werte der Grünen in Baden-Württemberg unter denen der AfD, sie sind auf dem dritten Platz. Dennoch punktet der Kandidat Özdemir mit Zustimmungswerten von 41 Prozent gegenüber seinem Konkurrenten Manuel Hagel von der CDU mit 17 Prozent bei der Frage, wer Ministerpräsident sein sollte, falls es eine Direktwahl gäbe. Für Caren Miosga stellte sich daraufhin die Frage, wieviel „Ballast“ seine Partei denn für Özdemir sei. Der entgegnete, dass „ich ganz in der Mitte meiner Partei bin“.
Die baden-württembergischen Grünen hätten hervorragende Politiker wie Winfried Kretschmann, Fritz Kuhn, Reinhard Bütikofer und Biggi Bender hervorgebracht. Die Landespartei habe ein „bisschen“ von den Sozialdemokraten, den Liberalen und den Christdemokraten aufgenommen – eine Umschreibung des bekannten Realo-Kurses der Landesgrünen. Er als Parteichef sei es gewesen, so Özdemir, der als erster den Daimler Dieter Zetsche und einen Handwerkerpräsident zu einer Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen eingeladen habe.
Ein milder Tonfall gegenüber Merz
Eher milde nahm Özdemir Stellung zur Stadtbild-Aussage von Kanzler Friedrich Merz (CDU). Der hätte „präziser formulieren“ müssen, so Özdemir, es reiche als Kanzler nicht aus, ein Problem als teilnehmender Beobachter zu formulieren, man müsse Lösungen schildern. Özdemir berichtete von einem doppelten Problem und warnte vor einer „holzschnittartigen Debatte“: So habe seine Tochter ein Zeltlager mit Freundinnen in Ostdeutschland abbrechen müssen, weil sie ständig rassistisch bedroht worden seien.
Auf der anderen Seite gebe es Probleme mit jungen Männern, die die Strapazen der Migration geschafft hätten, und häufiger straffällig würden als andere. Sie müssten auf die Spielregeln verpflichtet werden:Einhaltung des Grundgesetzes, Erwerbstätigkeit statt Sozialbezug sowie Erwerb des Deutschen als allgemeiner Verkehrssprache. Dass Berliner Grüne wegen der Stadtbildäußerung gegen Merz Strafanzeige gestellt haben, sieht Özdemir skeptisch: „Es löst doch nichts, wenn wir uns jetzt quasi vor Gericht wiedersehen.“