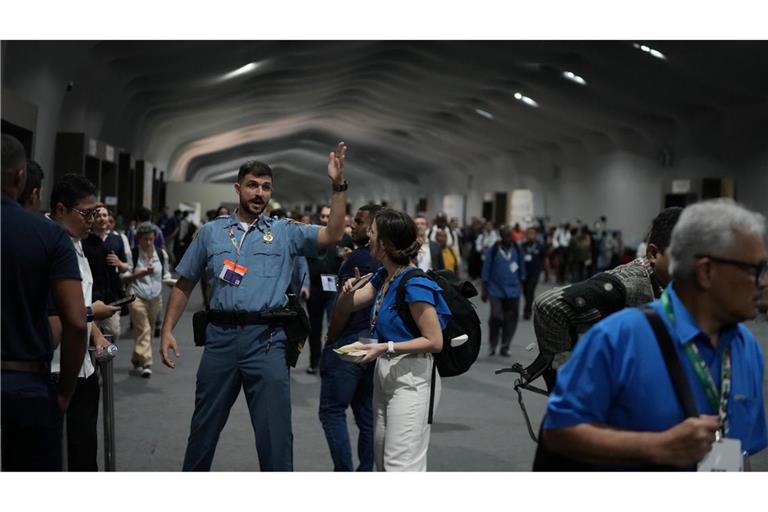Vertrauen
„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.“ Diese Redewendung wird dem russischen Politiker und Revolutionär Wladimir Iljitsch Uljanow Lenin zugeschrieben. Sie will besagen: Man soll sich nur auf das verlassen, was man nachgeprüft hat. Vertrauen ist nicht nachprüfbar und nicht beobachtbar. Man muss dem anderen trauen, dass er sich an Absprachen, Spielregeln und Vereinbarungen hält und einen nicht linkt. Wenn es um belanglose Dinge geht, reicht das in der Regel aus. Aber je komplexer Aufgaben und Organisationsstrukturen sind, umso schwieriger ist es mit dem Vertrauen.
Vertrauen stammt vom gotischen „trauan“. Darin steckt das Wort „treu“. Im Lateinischen spricht man von „fides“, Treue – im Griechischen von „pistis“, Glaube. Treue und Glaube gehören zusammen, das eine ist nicht ohne das andere denkbar. Vertrauen muss man sich verdienen. Es ist ein Erfahrungswert. Der mittelalterliche Theologe und Philosoph Thomas von Aquin drückt es so aus: Vertrauen basiert auf der Erfahrung, dass die Hoffnung auf Erfüllung von erwarteten Zuständen bekräftigt wird.
Wie sehr der Mensch ein Vertrauender ist, zeigt sich am Urvertrauen des Säuglings. Ein Säugling ist wie eine „Tabula rasa“ – eine unbeschriebene Tafel des Misstrauens. In ihm ist keine Falschheit, kein Zorn, keine Hinterlist. Er vertraut blind. So wie das Leben ist ihm das Vertrauen geschenkt – und die Hoffnung, niemals enttäuscht zu werden. Jammerschade, dass dieses Urvertrauen allzu schnell verloren geht.