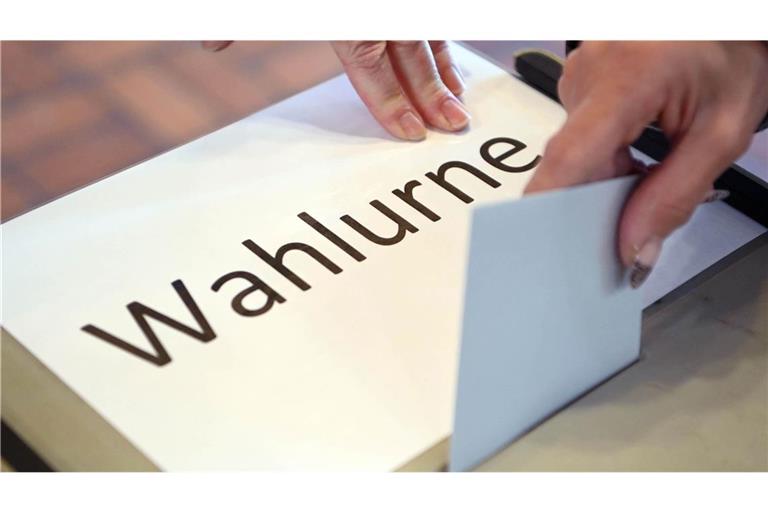Zugunglück in Riedlingen
Die Anatomie eines Einsatzes – so gehen Rettungskräfte vor
Wenn ein Notruf kommt, Menschenleben in Gefahr sind, dann muss es schnell gehen. So sind die Abläufe geregelt.

© Thomas Warnack/dpa
Feuerwehr, Rettungsdienste, THW und Polizei arbeiten in Riedlingen eng zusammen.
Von Christine Bilger
Alarm – ein Unglück geschieht, ein Notruf kommt an der Leitstelle an. Was dann geschieht, ist genau geregelt. Denn: Es geht um Minuten, um Verletzen helfen zu können. Wie die Rettungskräfte der Reihe nach in Bereitschaft versetzt werden, schildert ein Sprecher des Innenministeriums.
Wer die 112 wählt, landet in der Integrierten Leitstelle (ILS). Integriert heißt sie, weil hier Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Kommune eng vernetzt sind. Die geschulten Mitarbeiter dort nehmen einerseits den Notruf an und alarmieren die Einsatzkräfte. Sie haben aber noch eine wichtige Aufgabe: Über das Telefon erklären sie den Anrufern Erste-Hilfe-Maßnahmen, so nötig. Auch dafür sind sie ausgebildet.
Damit alle genau wissen, um welche Art der Notsituation es sich handelt, werden sogenannte Einsatzstichworte zugeteilt. „Für alle erdenklichen Schadenslagen sind in der Einsatzplanung die notwendigen Einsatzmittel hinterlegt, die für die Gefahrenabwehrmaßnahmen notwendig sind. Diese Zuordnung wird als Alarm- und Ausrückeordnung bezeichnet“, teilt der Ministeriumssprecher mit. Unterstützt von einem Einsatzleitrechner können so alle „tatsächlich benötigten und nächstgelegenen Einsatzmittel“ alarmiert werden. Das Wort Mittel ist etwas irreführend: Gemeint ist hier nicht nur das Material, sondern auch die Menschen, die eingreifen.
- Wenn sich am Ort des Geschehens herausstellen sollte, dass die erste Meldung nicht ganz stimmte, wird das Einsatzstichwort geändert. Dann können entweder zu viel alarmierte Kräfte entlassen oder weitere hinzugeholt werden. Hauptamtliche Kräfte starten als erste
- Einen direkten Alarm bekommen die hauptamtlichen Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr. Sie können nach dem digitalen Signal sofort zum Einsatzort starten.
- Ehrenamtliche Kräfte haben digitale Meldeempfänger bei sich. Sie machen den Großteil der Einsatzkräfte bei den Feuerwehren, den Sonderrettungsdiensten wie Berg- und Wasserrettung und des Fachdienstes Sanität und Betreuung aus. Diese Helferinnen und Helfer fahren dann sofort zum Stützpunkt ihrer Organisation – zum Beispiel zum Feuerwehrhaus. Das Alarmierungsnetz ist unabhängig vom Handynetz, es funktioniere auch bei Stromausfall.
- Von ihrer Unterkunft aus starten die Ehrenamtlichen ihre Einsatzfahrt. Der Ministeriumssprecher betont, dass ein sehr enges Netz an Standorten vorgehalten werde, um möglichst schnell an Ort und Stelle zu sein und helfen zu können. „Alleine die Gemeindefeuerwehren verfügen über deutlich mehr als 3000 Feuerwehrhäuser in Baden-Württemberg. Das Ziel, spätestens zehn Minuten nach Alarmierung mit der ersten Löschgruppe an der Einsatzstelle einzutreffen, kann damit fast flächendeckend erreicht werden“, so der Sprecher. Führungskräfte achten beim Erkunden darauf, ob Gefahren bestehen
- Als erste erkunden die Führungskräfte von Polizei und Feuerwehr die Lage am Einsatzort. Sie sollen feststellen, welche Personen verletzt sind und welche Schäden entstanden sind. Dabei schauen sie auch darauf, ob für die Einsatzkräfte eine Gefahr besteht – etwa durch eine herabhängende Oberleitung, austretende Giftstoffe oder einstürzende Bauten.
- Dann stimmen sie die notwendigen Maßnahmen des Einsatzes ab – und zwar übergreifend für alle Organisationen. Auch eine Priorisierung der Aufgaben erfolgt – was ist zuerst zu tun? Damit das so reibungslos wie möglich klappt, werden solche Einsätze immer wieder geübt. „Die Zusammenarbeit der Organisationen funktioniert sehr gut“, sagt der Pressesprecher. Das haben im aktuellen Fall auch Vertreter von THW und DRK gegenüber unserer Zeitung bestätigt.
- Damit das alles immer reibungslos klappt, üben die Einsatzkräfte regelmäßig die Abläufe für sogenannte Großschadenslagen. Die Konzepte werden überprüft und fortgeschrieben.