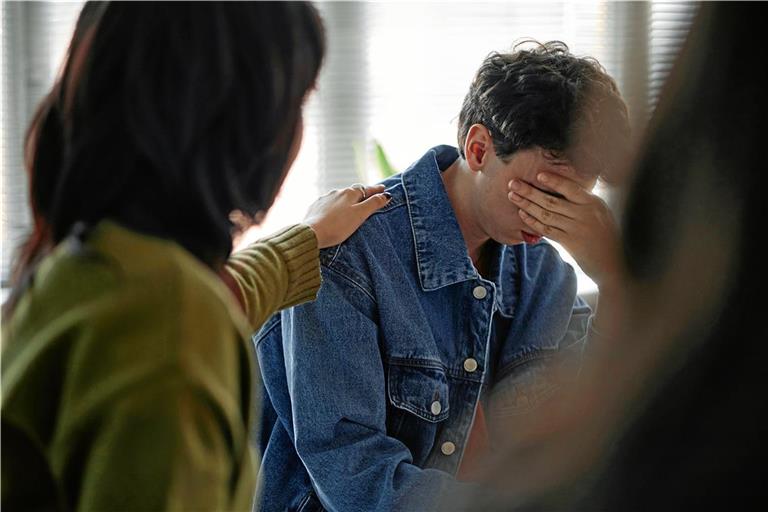Wenn Helfer Hilfe leisten: Ein Notfallseelsorger berichtet
Interview Diakon Carsten Wriedt ist als ehrenamtlicher Notfallseelsorger im Einsatz, wenn Rettungskräfte oder Betroffene schreckliche Situationen erleben, die ihre Seele verletzen. Bekommen Traumatisierte Erste Hilfe für ihre Seele, steigen die Heilungschancen.

© Alexander Becher
Notfallseelsorger Carsten Wriedt hilft Betroffenen und Einsatzkräften, schreckliche Erlebnisse zu verarbeiten. Foto: Alexander Becher
Am 29. April ist auf der B14 zwischen Sulzbach und Großerlach ein schlimmer Verkehrsunfall passiert, bei dem zwei Autofahrer trotz Rettungsversuchen noch an der Unfallstelle verstarben. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden von einem Nachsorgeteam betreut. Waren Sie Teil des Teams?
Ich bin mit unserem Nachsorgeteam bei den Einsatzkräften gewesen, die vom Unfallort zurückkamen. Am Unfallort selbst waren Kollegen von der psychosozialen Notfallversorgung, PSNV-B. So wird das unterschieden: E für Einsatzkräfte, B für Betroffene. Auch waren Kollegen mit der Polizei unterwegs, um Angehörigen die Todesnachrichten zu überbringen. Da war richtig viel Aufmarsch, aber im guten Sinne. Die Einsatzkräfte haben engagiert gearbeitet, doch es ging eben auch bei ihnen, wie man so sagt, über die Hutschnur. Nicht nur dass es zwei Tote gab, das ist leider relativ normal. Aber wie die genauen Umstände waren, wie das Setting im Ganzen war, dazu eintreffende Angehörige am Unfallort. Da gibt es Herausforderungen, die schafft man nicht allein. Das muss man auch nicht, dafür sind wir da. Das allerdings ist erst in den letzten Jahren ins Bewusstsein gekommen.
Sie meinen, dass auch Einsatzkräfte in Situationen kommen, in denen ihre Seele Erste Hilfe benötigt?
Psychotraumatologie gibt es erst seit ungefähr 30 Jahren. Erste Ansätze waren im Ersten Weltkrieg erkennbar, durch das Kriegszittern. Man hat gemerkt, Soldaten sind nicht mehr sie selbst. Doch man konnte damit nicht viel anfangen und eigentlich war das Interesse, dass die Soldaten wieder wehrfähig werden. Es ging nicht um den Menschen. Auch nach dem Vietnamkrieg gab es Erscheinungen, dass man registriert hat: Die Leute sind völlig verändert. Es setzte allmählich der Grundgedanke ein, das Wort Trauma, das ursprünglich nur Verletzung heißt, vom körperlichen auf das psychische Befinden zu übertragen. Mit dem Flugtagunglück von Ramstein 1988 wurde bewusst, dass man neu nachdenken muss, was die Einsatzkräftetätigkeit angeht. Auch Einsatzkräfte sind irgendwann so geschockt und belastet, dass nichts mehr geht. Dann kam das große ICE-Unglück von Eschede. Sehr viele Geistliche aus der Umgebung gingen einfach vor Ort. Es war zwar alles noch ein unstrukturiertes Tun, aber ein gutes, wichtiges Tun. Ohne diese Pioniere hätten wir heute nicht das, was wir psychosoziale Notfallversorgung nennen.
Das heißt, die Notfallseelsorge hat sich inzwischen etabliert?
Durch die bundesweite Zusammenarbeit der Hilfsorganisationen, der Kirchen und der Wissenschaft ist eine standardisierte Ausbildung entstanden. Seit 2010 gibt es eine klare Ordnung. Neben den Bereichen Betroffene und Einsatzkräfte ist ganz neu eine dritte Gruppe dazugekommen, die PSNV-H für Helfende. Bei der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal haben sich viele Leute hingestellt und mit angepackt. Das war toll. Andererseits waren diese Helfer menschlich und psychisch unvorbereitet. Wenn Helfende plötzlich Todesopfer sehen oder die Reaktionen von Angehörigen mitbekommen, sind sie eine besondere Gruppe. Ein Helfender kann nicht ahnen, wo er hineingerät und welche Ereignisse er verarbeiten muss.
In Ihren Ausbildungen haben Sie das Werkzeug bekommen, um unterschiedlichen Charakteren, Menschen sind ja individuell, in unterschiedlichen Situationen gerecht zu werden. Wie gehen Sie vor?
Jeder Mensch ist eine einmalige Persönlichkeit und bringt in die Notfallsituation eine persönliche Herkunft ein. Das trägt dazu bei, was ein Ereignis mit einem macht. Wie kann ich Belastendes verarbeiten? Was gehört in meinem Weltbild dazu? Zum Beispiel der Glaube? Aber nicht alle Menschen können und müssen gläubig sein. Es gibt ein paar Standardgrundgedanken: Jeder kann geschockt sein. Die Schocksituation ist bei jedem medizinisch einigermaßen vergleichbar. Aber wie geht es weiter, wenn wir ins Gespräch kommen? Wir Notfallseelsorger kommen nicht als Missionare und wollen niemanden bekehren. Der Mensch und der Notfall stehen im Vordergrund. Wie reagiert jemand? Wie nehmen wir diesen Menschen wahr? Wir müssen versuchen zu spüren: Was ist jetzt an der Reihe?
Können Sie das noch weiter erklären?
Mein interessantester Einsatz in der Hinsicht war, dass ich zweieinhalb Stunden nichts gesagt habe, weil ich das Gefühl hatte, es ist gut, dass ich da bin. Ich spürte, die Person war in sich. Was hätte ich sagen sollen? Dann merkte ich, jetzt kehrt die Person langsam in diese Welt zurück. Ein paar Sätze haben wir gesprochen, aber nicht viel. Berührend war, mit welchen Worten sich die Person bedankt hat: „Wie gut, dass Sie da waren.“ Das ist tatsächlich die Hauptaufgabe. Ob wir etwas machen, was wir tun, müssen wir versuchen zu spüren. Wir müssen mit allem rechnen, auf alles vorbereitet sein und selbst überhaupt nichts wollen.
Sind Verkehrsunfälle die häufigsten Einsätze, zu denen Sie gerufen werden? Welche Situationen sind es noch?
Die meisten Einsätze sind plötzliche Todesfälle, aber nicht unbedingt per Unfall, sondern dass jemand nachts im Bett verstirbt oder nachmittags ein Nickerchen macht, das nicht mehr aufhört. Auch wenn eventuell noch reanimiert wurde und der Notarzt irgendwann erklären muss, dass jemand nicht ins Leben zurückzuholen ist, ist das eine schwierige Situation. Die Todesnachricht zu überbringen, ist eine weitere wesentliche Aktivität. Wir gehen zusammen mit der Polizei zu den Angehörigen. Die Reaktionen reichen von null bis 100, von völliger Apathie bis zu völligem Ausrasten oder Zusammenklappen oder zur Selbstgefährdung. Meine längste Todesnachricht ging über vier Stunden. Es gab da alles an Reaktionen. Ich war sehr froh, dass die Polizeistreife die ganze Zeit dageblieben ist. Ich hätte das allein nicht schaffen können, es war sehr anstrengend. Aber wir haben es miteinander doch ordnen können. Als wir draußen waren, haben die Polizisten und ich noch geredet. Auch das tat gut.
Ihnen auch? Sie sind schließlich auch Einsatzkraft und benötigen vielleicht einmal seelsorgerischen Beistand.
Da habe ich mit anderen Menschen, die gläubig sein dürfen, schon eine Möglichkeit, etwas loszuwerden. Im Gottesdienst oder im persönlichen Gebet kann ich diese Situation vor Gott bringen. Das ist ein Stück weit ablegen, ein Weitergeben der Last. Wer das für sich nicht leben und glauben kann, muss anders damit umgehen, zum Beispiel durch Teilnahme an Supervision. Viele Einsatzkräfte bei der Feuerwehr, im Rettungsdienst und in der Notfallseelsorge handhaben es so: Wenn wir unsere Einsatzjacke und persönliche Schutzausrüstung ausziehen, ist das wie ein Ritual, um zu sagen: „Jetzt hänge ich die Jacke hier an den Haken und damit hänge ich den Einsatz an die Wand.“ Das darf man nicht unterschätzen, das ist wichtig. Trotzdem sind damit nicht alle Eindrücke ausgelöscht. Aber das soll auch gar nicht sein. Wir müssen immer eine Balance finden. Wir sind und bleiben Menschen. Das müssen wir sein.
Weshalb ist es wichtig, nach Unglücksfällen Hilfe für die Seele zu bekommen?
Weitere Themen
Erste Hilfe für die Seele ist manchmal ganz entscheidend. Wie gehts nämlich weiter? Dazu gehört, dass der Verletzte seine Verwundung wahrnimmt, dass er ein erstes Hilfeangebot in dieser Gesprächsform bekommt. Die Chancen, zu regenerieren, sind dadurch ungleich größer. Wenn ich eine Anleitung und Hinweise zum Umgang mit der seelischen Verletzung bekomme, ist der Weg in die Heilung grundsätzlich sehr gut. Notfallseelsorge ist zugleich Prävention für die kommende Zeit. Was hätten wir von unseren Feuerwehrleuten, wenn sie aufgrund schwerwiegender Ereignisse der Reihe nach aussteigen oder ausfallen würden?
Also enthalten diese Gespräche schon auch Ratschläge oder Tipps?
Ganz genau, das nennt man Psychohygiene. Es sind nicht Ratschläge im vorschreibenden Sinne, sondern wir schildern den erfahrungsgemäßen Verlauf. Wichtig ist der Hinweis, keine Angst vor der Verarbeitung zu haben, zum Beispiel dass man träumt, einen düsteren Flashback hat oder ein Vermeidungsverhalten anwendet. Das ist Verarbeitung und keine psychische Störung. Wenn man aber nach vier bis sechs Wochen das Gefühl hat, nicht selbst herauszukommen oder dass sich gar nichts ändert, ist der Weg in die professionelle, psychotherapeutische Behandlung angezeigt. Psychohygiene erläutern wir auch den Betroffenen. Wobei das möglicherweise anders gelagert ist. Wenn ich zum Beispiel den Partner liebevoll eingeschlafen im Bett finde, habe ich keine schrecklichen Bilder gesehen, aber trotzdem ein Ereignis. Hier gehört zur Verarbeitung auch, die Betroffenen ins Tun zu bringen, zum Beispiel dass sie einen Bestatter benachrichtigen. Diese Verarbeitungsform hat der Feuerwehrmann nicht. Er trauert nicht persönlich um einen Unfalltoten. Der Feuerwehreinsatz ist irgendwann zu Ende, aber die Bilder sind da. Sie können nicht über Aktionen verarbeitet werden.
Die Notfallseelsorge steht auch bei der bevorstehenden Fußball-Europameisterschaft zum Einsatz bereit, richtig?
Das gehört zum Lernen aus Großschadenslagen. Wir haben bei allen Spielen in Deutschland eine Staffel von PSNV-Kräften vor Ort und eine weitere als sogenannte zweite Welle. Wenn man merkt, dass mehr Einsatzkräfte benötigt werden, sitzen diese schon in der Wache bereit. Ich werde auch in der zweiten Welle sein: Wir sind in der Waiblinger DRK-Wache und fahren im Einsatzfall nach Stuttgart. Die Koordination und Abfrage, wer sich wann bereit erklären kann, laufen bereits seit dem vergangenen Jahr. Insofern merken wir, dass die notfallseelsorgliche Arbeit immer mehr in den Katastrophenschutz mit integriert wird. Wir wissen, Großereignisse sind nicht mehr automatisch friedlich. Ich hoffe sehr, dass wir nicht gebraucht werden.
Das Gespräch führte Nicola Scharpf.
Persönliches Carsten Wriedt wurde 1961 in Hamburg geboren. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.
Werdegang Wriedt studierte in Lübeck, Hamburg und Berlin für das Lehramt an Gymnasien im Fach Musik und belegte den künstlerischen Studiengang Violine. Abschluss 1989 in Berlin. Von 1988 bis 2009 war er erster Geiger im württembergischen Kammerorchester Heilbronn. In der Mitte seines beruflichen Lebens eröffnete sich etwas total Neues: 2007 wurde er von Bischof Gebhard Fürst zum Diakon geweiht und 2009 zum hauptberuflichen Diakon in St. Peter und Paul (Deutschordensmünster Heilbronn) berufen. Seit Februar 2022 ist er als Diakon in St. Johannes und Christkönig in Backnang sowie mit der Profilstelle Hospizarbeit/Trauerpastoral im Dekanat Rems-Murr beauftragt. Er ist Ansprechpartner für Fragen rund um Trauersituationen.
Ehrenamt Seit 2013 ist Carsten Wriedt in der Notfallseelsorge tätig. Nach der Grundausbildung, der Ausbildung als Leitungskraft und der Ausbildung für die Nachsorge bei Einsatzkräften ist er heute ehrenamtlicher Notfallseelsorger im Dekanat Rems-Murr.
Vortrag Wriedt bietet im Rahmen einer VHS-Veranstaltung „Erste Hilfe für die Seele“ am Dienstag, 4. Juni, von 18.30 bis 20.30 Uhr Einblicke in seine Tätigkeit als Notfallseelsorger. Die Zuhörer können sich erzählen lassen, wie diese Arbeit aussieht, was Notfallseelsorger erleben, warum sie diese Form der Ersten Hilfe leisten – und die Teilnehmer können Fragen stellen. Anmeldung über die VHS.