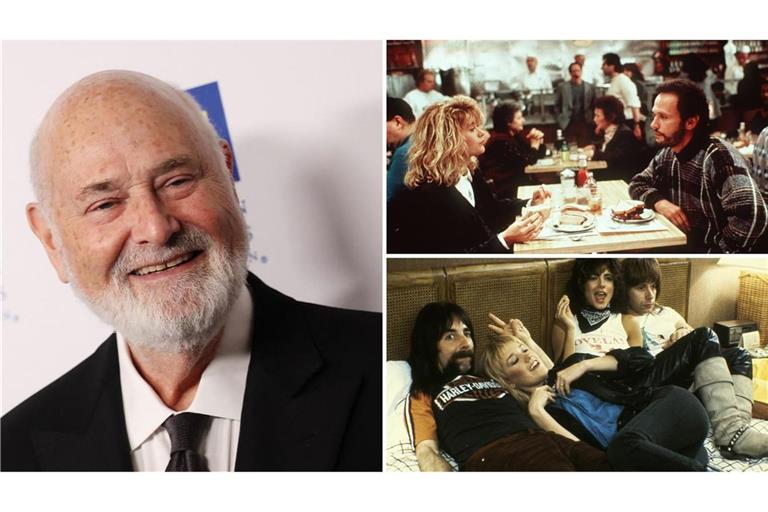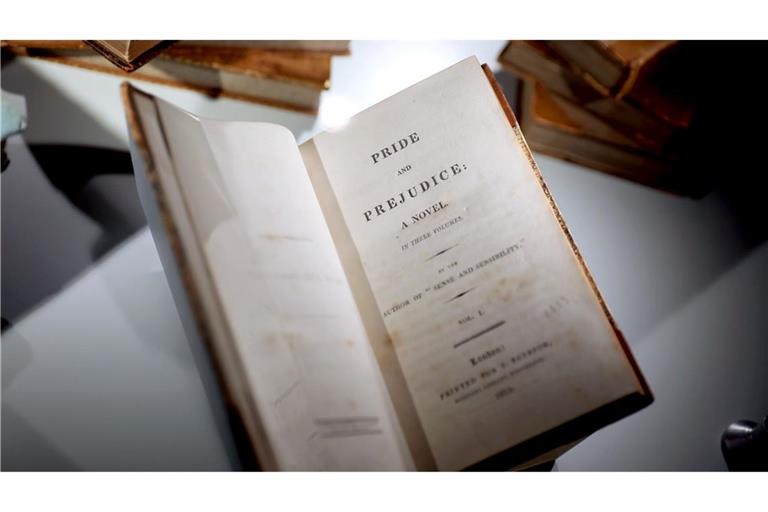Der menschliche Makel
Die Legende des Malers Emil Nolde erscheint in neuem Licht – das zeigt die aktuelle Ausstellung seiner Werke in Berlin
Ausstellung - Expressionist und Entarteter, Antisemit und Nazi: Die Berliner Schau „Emil Nolde, eine deutsche Legende – Der Künstler im Nationalsozialismus“ lässt den Maler in neuem Licht erscheinen. Sie beantwortet Fragen und wirft zugleich neue auf.
Berlin Drei martialische Wellen brechen über die Leinwand, darüber dräuende Gewitterwolken, vermischt mit bedrohlich flammendem Abendrot. Emil Nolde malte diese hochdramatische Nordmeer-Metapher „Brecher“ im Jahr 1936. Sie hing, eine Leihgabe der Staatlichen Museen, jahrelang im Amtszimmer der Bundeskanzlerin. Vor wenigen Tagen hat Angela Merkel die Tafel zurückgegeben, zunächst für die heute beginnende Nolde-Ausstellung der Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof. Merkel will das Gemälde aber nicht wiederhaben, weil es über den gefeierten Expressionisten ganz neue historische Erkenntnisse gibt. Sechs Jahre Forschungsarbeit von Aya Soyka und Bernhard Fulda im Archiv der Nolde-Stiftung Seebüll ergeben ein anderes Bild des Schleswiger Meisters der koloristischen und sinnlichen Übersteigerung, des Zusammenklangs der Farbe, dem die Malerei, wie er es bekundete, ein farbiges Gleichnis der Welt gewesen ist.
Emil Nolde (1867–1956), der ab 1906 für kaum ein Jahr Mitglied der Expressionistengruppe Die Brücke war, hat in seinem Malerleben etliche der gefährlichen Sturzwellen der Nordsee gemalt. Naturschauspiele lagen ihm genauso wie monumentale Blumen, gleichnishafte biblische Szenen, urbildliche Menschenkinder, wie er nachgerade apotheotisch die „Wilden“ auf seiner Südseereise malte. Und er setzte, als der an die Macht gekommene Sonntagsmaler Hitler seine Motive, sogar die grandiosen „Sonnenblumen“ verabscheute, Nolde gar als entartetes „Schwein“ bezeichnete, umso mehr Mythen-Motive der Germanen und Wikinger mit Aquarell auf Papier.
Diese „Ungemalten Bilder“, die zur Legende des Malers als NS-Opfer beitrugen – befördert durch Siegfried Lenz’ Roman „Deutschstunde“ –, hängen jetzt gereiht in einer erhellenden, unaufgeregten, klar gegliederten, akribisch erarbeiteten Schau der Nationalgalerie im Museum Hamburger Bahnhof.
Großartige Malerei streitet da heftig mit unwiderlegbaren Beweisen, dass Nolde Antisemit war, sich den Nazis andiente, obwohl sie ihn doch ablehnten – und er dennoch bis zuletzt an sie glaubte. In einem Brief aus den Vierzigern macht der Maler die „Weltverschwörung der Juden“ verantwortlich für den barbarischen Krieg. Schon im Sommer 1933, das ergaben die Forschungen, hatte Nolde sogar einen „Entjudungsplan“ entworfen: Den wollte er Hitler vorlegen. Dieser rassistische Hass dürfte aus einer Grundverletzung gewachsen sein. Nolde war 1910 mit seinem Bild „Pfingsten“ für die Sezessionsschau von jüdischen Malern um Max Liebermann strikt abgelehnt worden.
Auf Dokumente, die das belegen, hatte Jolanthe, Noldes zweite, 2010 verstorbene Frau (seine Gattin Ada starb 1946), in der Seebüller Stiftung eisern die Hand gehalten, auf Deutungshoheit gepocht, den Zugang der Forscher verhindert. Dass Nolde sein NSDAP-Mitgliedsbuch nie zurückgegeben hat, auch nicht, als seine Bilder in der Aktion „Entartete Kunst“ massenhaft verfemt, beschlagnahmt, verhökert wurden, war längst bekannt. Aber es spielte in der Rezeption bislang kaum eine Rolle. Auch nicht in der späten DDR, wo seine Südseebilder in den Achtzigern in einer Schau Hunderttausende begeisterten. Nach 1945 hatte der als Opfer der NS-Kulturpolitik anerkannte Maler aus dem nordfriesischen Seebüll, von seinem Atelierhaus aus, begonnen, im Kunstbetrieb wieder auf sich aufmerksam zu machen. Das gelang, er wurde schleunigst „entnazifiziert“, später mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.
Aber Emil Nolde war ein Zwiegespaltener, ein Farbmagier mit düsterer Seite. Nun schwappen, um im Bild des „Brecher“-Motivs zu bleiben, die brachialen Wellen über die Maler-Legende. Dabei hängt das betreffende Gemälde ganz am Ende der Schau, die fairerweise mit fulminanten klassischen Expressionisten-Motiven beginnt, mit der „Sünderin“ von 1926 und mit Adam und Eva im „Verlorenen Paradies“, 1921.
Es ist unbegreiflich, aber Nolde hatte den Nazis die Feme offenbar nicht übel genommen; er wollte deren Anerkennung, hatte nicht begriffen, dass er mit seinem expressionistischen Malstil diametral gegen das stand, was Hitler von der neuen deutschen Kunst verlangte. Und nie hat er sich deutlich von der NS-Ideologie und den antisemitischen Äußerungen distanziert. Auch stimmt es nicht, dass er die „Ungemalten Bilder“ heimlich, also in einer Art inneren Emigration, gemalt hat. Die Nazis beschlagnahmten tausend seiner Bilder, aber belegten ihn nicht mit Malverbot. Jenes, so die Forscher, gehört ins Reich der Selbst-Stilisierung.
Muss jetzt also die Nolde-Kunstgeschichte neu geschrieben werden? Auf jeden Fall lesen wir seine viel bewunderte Kunst jetzt neu. Und sehr viel lesen müssen wir in dieser anspruchsvollen, unbequemen, die politische, moralische Widersprüchlichkeit einer Ikone thematisierenden Schau. Vor allem sehen wir die mythischen Opferszenen, die nordischen Sagengestalten nun ganz anders. Nolde ist eben nicht nur ein Teil der Kunstgeschichte, vielmehr stellt er den Kardinalfall einer so noch nicht wahrgenommenen deutschen Kunstgeschichte dar. Das so lange unzugängliche Archiv wurde den Forschern zur bisweilen schockierenden Offenbarung, Waschkörbe voller Briefe und Tagebuchnotizen sprechen Bände von Emil Noldes Anerkennungssucht und Zerrissenheit. Erst seit 2016 gibt es einen Archivar, der an die 30 000 Dokumente erfasst, digitalisiert und online stellt.
Die Forschung legt vor, was war. Das Publikum wird sich selbst ein Bild machen müssen, moralisch wie ästhetisch. Eine Deutungsvorgabe, auch über das Verhalten von Künstlern in der Diktatur, gibt die Schau nicht: Emil Nolde, dieser Säulenheilige des Expressionismus, war zweifellos ein Mal-Genie. Aber er war auch ideologisch verbohrt, eitel, zerrissen, widersprüchlich.
Am Beispiel Emil Noldes können wir viel über Deutschland und geschichtliche Verdrängung lernen. Wir können und müssen die Bilder befragen und mit den biografischen Dokumenten abgleichen, um nach Antworten darauf zu suchen, ob Kunst wirklich nur Kunst ist.